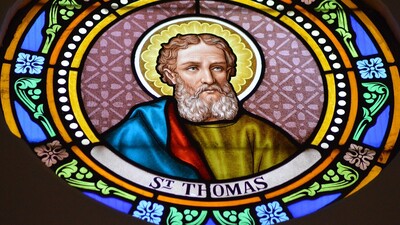Leid und Sterben ein Gesicht geben
Falten machen uns Angst, weil sie an den Tod erinnern
Ich stehe vor einem Regal in der Kosmetikabteilung und suche ein Geschenk für meine Oma. „Irgendwas Schönes für die reifere Haut“, sage ich zu der Verkäuferin. Da dreht sich eine alte Dame zu mir um, nimmt eine Creme aus dem Regal und hält sie mir hin: „Also ich nehme seit Jahren nur noch die hier. Die gefällt ihrer Großmutter bestimmt auch.“
Ich bin überrascht. Was ist denn an dieser Creme so gut? „Ja, schauen Sie doch mal, wie toll meine Falten damit aussehen!“ sagt sie prompt und zeigt auf ihr Gesicht. Wie bitte, diese Creme soll mich überzeugen, weil sie tolle Falten macht?! Einen Moment stutzen wir beide, dann fängt die Dame so zu lachen an, dass um ihre Augenwinkel herum tausend kleine Linien erschienen. „Naja, sie wissen doch, wie ich das meine.“
In dem Moment freuen wir uns beide, weil wir wissen, dass niemand Werbung mit „tollen Falten“ machen würde. Und dass das eigentlich sehr schade ist. Denn die Frau sieht wirklich toll aus: Frisch und lebendig. Und jedes Fältchen wirkt so, als würde es genau da hingehören, wo es ist.
Menschen, die sich im Alter schön finden und ihre Lach- und Sorgenfalten selbstbewusst tragen, die müsste es viel mehr geben. Das findet auch die Autorin Katja Eichinger. Aber in ihrem Buch „Mode und andere Neurosen“ beschreibt sie, dass es gerade für Frauen immer schwieriger wird, zu ihrem Aussehen zu stehen. Maßstab sind die scheinbar perfekten Fotos, die uns im digitalen Zeitalter ständig umgeben. Nichts soll ans Älterwerden erinnern. Nichts soll darauf hinweisen, dass jeder von uns nur lebt, um irgendwann wieder zu sterben.
Deshalb sind Falten oft tabu. Wir mögen sie nicht, weil sie uns Angst machen. Sie erinnern uns an das Altwerden und an unseren Tod. Und wer wird daran schon gerne erinnert?! Auf den ersten Blick ist es viel einfacher, solche Gedanken zu verdrängen. Aber gleichzeitig weiß ich: Es ist nicht gut, Ängste auszublenden. Je mehr man das tut, desto stärker werden sie.
Es ist nicht gut Ängste zu verdrängen. Das ist meine Erfahrung. Lieber blicke ich ihnen klar und deutlich ins Gesicht. Dabei hilft mir der Karfreitag. An diesem Feiertag begegne ich meinen Ängsten vor Leid und Sterben. In der Geschichte am Karfreitag geht es zwar nicht ums Älterwerden, aber um die Ängste, die damit verbunden sind. Jesus gibt ihnen ein Gesicht. Das, wovor ich mich insgeheim fürchte, sehe ich in der Geschichte direkt vor mir: Jesus fühlt sich einsam. Im Garten Gethsemane sollen seine Freunde ihm beistehen. Aber sie bekommen von seiner Angst gar nichts mit und schlafen ein. Damit nicht genug. Judas verrät seinen Aufenthaltsort. Und als Jesus verhaftet wird, hält noch nicht mal sein Freund Petrus zu ihm. Er leugnet sogar, dass er ihn kennt. Niemand steht ihm bei. Schließlich wird Jesus zum Tode verurteilt und ans Kreuz genagelt. Kurz vor seinem Tod schreit er: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Er fühlt sich im wahrsten Sinne von Gott und den Menschen im Stich gelassen.
Der Blick auf Jesus gibt den Ängsten vieler Menschen ein Gesicht. Wir fürchten uns nicht vor dem Tod am Kreuz. Aber die Angst vor Leiden und Sterben kennen die meisten von uns auch. Oder das Gefühl hilflos zu sein: Ich brauche Hilfe und niemand kümmert sich. Oder ich habe furchtbare Schmerzen, gegen die es keine Medikamente gibt.
In der Corona-Pandemie sind solche und ähnliche Ängste für viele plötzlich wahr geworden: Manche haben zum Beispiel erlebt, wie es ist, einsam zu sein. Ihre Kinder und Enkel besuchen sie nicht, weil sie Angst haben, die alten Eltern oder Großeltern anzustecken.
In diesem Zusammenhang taucht das Gesicht von Christina vor meinem inneren Auge auf: Ein Jahr ist es her, da verliert sie mitten in einer Zoom-Konferenz die Fassung. Völlig aufgelöst erzählt sie uns, dass ihre Mutter in Rom im Krankenhaus mit dem Tod kämpft und sie nicht zu ihr darf.
Viele Kranke mussten einsam sterben. Auf Intensivstationen haben Schwestern, Ärztinnen und Ärzte um Fassung gerungen, weil so viele Patienten einfach nicht zu retten waren.
Schaue ich am Karfreitag auf Jesus, tauchen noch andere Gesichter vor mir auf: Zum Beispiel Gianni, der gerade eine Kaffeebar eröffnet hat. Jetzt verdient er nichts und weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Ich denke an unsere Kinder, die sich danach sehnen, sich wieder mit allen Freunden zu treffen.
Diese Pandemie hat so vielen Menschen Leid gebracht. Und von dem Meisten bekommen wir kaum was mit. Jeden Tag sehen wir die Zahlen in den Nachrichten, aber oft nicht die Menschen, für die sie stehen.
Es sind ganz unterschiedliche Bilder, die dieser Jesus am Kreuz hervorruft. Jeder von uns hat andere Gesichter vor Augen. Aber so verschieden sie auch sind – durch sie setzen wir uns mit Leid und Sterben auseinander. Nicht wegschauen, sondern es aushalten und darüber nachdenken.
Wer seine Angst vor dem Tod nicht verdrängt und seine Augen vor dem Leid nicht verschließt, der bewältigt sein Leben oft besser. Weil er sich seiner Gefühle bewusst ist. Aber es geht heute noch um viel mehr: Karfreitag kann den Blick aufs Leben komplett verändern. Jesus leidet und stirbt, aber dabei bleibt es nicht. Die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Das Grab, in das er gelegt wird, ist am Ostermorgen leer. Gott hat ihn auferweckt. Unvorstellbar. Selbst bei den Jüngern von Jesus dauert es eine ganze Weile, bis sie begreifen, er ist wirklich lebendig. Erst nach Ostern erkennen sie im Rückblick: Im Leiden haben sie Jesus zwar im Stich gelassen, aber Gott war bei ihm. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Gott überwindet ihn und schenkt ewiges Leben.
Der Blick auf Jesus am Kreuz erinnert daran und kann unser Vertrauen stärken: Er sagt uns: Wir sind nicht so allein und hilflos, wie wir uns manchmal fühlen. Gott steht uns in unserem Leiden und Sterben bei. Er ist bei uns in allem, was uns Angst macht. Manchmal spüren Menschen, die etwas Schweres durchmachen: Gott ist bei mir. Er schenkt mir auf ungeahnte Weise Kraft. Und ich gehe gestärkt ich aus der Krise raus. Andere fühlen sich getröstet, weil sie beim Abschied von einem geliebten Menschen darauf vertrauen: Er oder Sie ist jetzt bei Gott.
Und wer so ein Vertrauen in sich spürt, der lässt sich nicht mehr so leicht entmutigen. Solche Menschen halten Leidenssituationen eher aus. Und sie sind auch für andere da, wenn das Leben traurig und schwer wird. In der Corona-Zeit habe ich diese Seite an manchen Menschen plötzlich entdeckt:
Da ist zum Beispiel ein DJ. Er findet es echt deprimierend, wie isoliert viele alte Menschen sind. Im Dezember 2020 montiert er kurzerhand seine Musikanlage auf einen Anhänger und legt Weihnachtslieder auf. Mitten auf der Straße- direkt vor dem Pflegeheim. Ich erinnere mich auch an die Lehrerin, die im Lockdown ihren VW-Bus umbaut: Mit ihrem kleinen Besprechungsraum besucht sie ihre Schülerinnen und Schüler, um mit ihnen persönlich zu sprechen. Und ich denke an die Erzieherin einer Kinderkrippe. Obwohl sie auch Angst hat, sich anzustecken, gibt sie den kleinen Kindern die Nähe und Geborgenheit, die sie brauchen.
Es tut gut, solchen Menschen zu begegnen. Ihre Hoffnung steckt an. Und wer hofft, dass sich etwas zum Guten ändert, der hat Mut auf andere zuzugehen und ihnen zu helfen.
Das wünsche ich mir auch für mich. Ich möchte meiner Angst vor dem Älterwerden ins Gesicht schauen. Und dann auf Gott vertrauen und über meine Falten lachen. Ich möchte mich anstecken lassen von der Hoffnung, die andere verbreiten. Und ich möchte im Gesicht von Jesus die Menschen entdecken, die in meinem Leben darauf warten, Hoffnung zu bekommen.