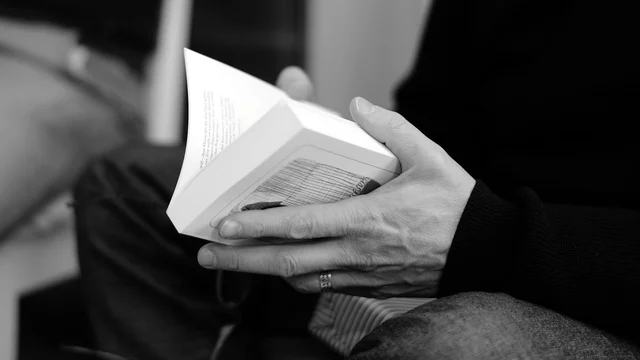Erzählte Lebenshilfe - 200 Jahre Grimms Märchen
Autorin:
Das Märchenbuch meiner Kindheit war dunkelgrün und sehr dick. Auf dem Leinenumschlag prangte golden der Froschkönig mit seiner Krone und darüber und darunter stand in alter Frakturschrift: Hausmärchen der Brüder Grimm. Das Buch war bei uns sehr beliebt, und das hatte auf Einband und Buchrücken sichtbare Spuren hinterlassen. An vielen Stellen waren Eselsohren eingeknickt, und bei bestimmten Märchen klappten die Seiten fast von alleine auf. „Vom Fischer und seiner Frau“, „König Drosselbart“, „Dornröschen“ und „Rumpelstilzchen“. Das Märchenbuch wirkte auf uns sehr alt. Das lag an der Fraktur- Schrift und den Bildern des Malers Ludwig Richter. Seine Illustrationen, auf denen sprechende Tiere, Königskinder, tapfere Helden und Hexen zu sehen waren, ließen eine verwunschene Welt entstehen, in die wir gerne eintauchten. Noch mehr trug dazu die eigentümliche Sprache der Märchen bei. Sie hatte etwas ungemein Anziehendes.
200 Jahre ist es her, dass die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm den ersten Band ihrer „Kinder- und Hausmärchen“ veröffentlichten.
Die Bibel in der Übersetzung Martin Luthers und die Märchen der Brüder Grimm gelten als die Bücher deutscher Sprache, die auf der Welt am weitesten verbreitet sind. Und das ist kein Wunder: Beide erzählen vom Leben. Beide wollen Erfahrungen deuten und dabei helfen, das Leben mit seinen Höhen und Tiefen zu be-stehen. Beide machen Hoffnung, so unterschiedlich sie sind. Und beide bringen alte Menschheitserfahrungen zur Sprache. Und zwar so, dass man sie behalten und weitererzählen kann. Und Mut bekommt man auch, wie ich am Beispiel des Märchens vom Aschenputtel zeigen möchte.
MUSIK
Sprecher:
„Einem reichen Manne dem wurde seine Frau krank, und als sie fühlte, dass ihr Ende herankam, rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich ans Bett und sprach: ,Liebes Kind, bleib fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen, und ich will vom Himmel auf dich herabblicken, und will um dich sein.‘ Darauf tat sie die Augen zu und verschied. Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zu dem Grabe seiner Mutter und weinte, und blieb fromm und gut. Als der Winter kam, deckte der Schnee ein weißes Tüchlein auf das Grab, und als die Sonne im Frühjahr es wieder herabgezogen hatte, nahm der Mann eine andere Frau.“
Autorin:
Diese Stiefmutter brachte in die Ehe zwei Töchter mit, die das Mädchen alsbald zur Küchenmagd erniedrigten. Es musste nun in der Küche leben, schmutzige Arbeit verrichten und die Gemeinheiten der Stiefschwestern erdulden. Da es neben dem Herd in der Asche schlafen sollte, war es immer schmutzig und wurde deshalb Aschenputtel genannt.
Als der Vater einmal seinen drei Töchtern von einer Reise etwas mitbringen wollte, erbat sich das Aschenputtel den ersten Zweig, der auf dem Weg an seinen Hut stoßen würde. Das war ein Haselzweig, den es auf dem Grab der Mutter einpflanzte und mit den eigenen Tränen begoss – bis aus dem Zweig ein schöner großer Baum geworden war. Ein kleiner weißer Vogel wohnte im Baum, der dem Aschenputtel Wünsche erfüllen konnte.
Dann lud der König zur Brautschau für den Königssohn alle schönen Jungfrauen ein. Da musste Aschenputtel seine Schwestern aufputzen. Die Stiefmutter wollte sie nur mitgehen lassen, wenn Aschenputtel eine Schüssel Linsen aus der Asche herauslesen konnte. Da kamen ihr zahme Tauben zu Hilfe und lasen „die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen“. Dem Verbot, zum Fest zu gehen, widersetzte sich Aschenputtel jedoch: der Haselnussbaum auf dem Grab der Mutter warf ihm ein golden und silbernes Kleid über und feine Pantoffeln. Der Königssohn wollte nur mit Aschenputtel tanzen. Aber das Aschenputtel gab sich nicht zu erkennen, und kehrte unerkannt auf seinen Platz in der Asche zurück. Das wiederholte sich, bis der Königsohn listig die ganze Treppe mit Pech bestreichen ließ. Als nun das Aschenputtel wieder davon lief, blieb ein Pantoffel auf der Treppe kleben. Der Ausgang ist bekannt: Niemandem passte der zierliche Pantoffel, auch als die Stiefschwestern sich Zehen und Ferse abhackten, um Königin zu werden. Die Tauben riefen dem Königssohn zu: „Rucke di guck, rucke di guck, Blut ist im Schuck. Der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.“
Als nun der Königssohn nach einer dritten Tochter fragte, antwortete der Vater:
Sprecher:
„,Nein, nur von meiner verstorbenen Frau ist noch ein kleines verbuttetes Aschenputtel da, das kann unmöglich die Braut sein.‘ Der Königssohn sprach, er sollte es heraufschicken, die Mutter aber antwortete: ,Ach nein, das ist viel zu schmutzig, das darf sich nicht sehen lassen.‘ Er wollte es aber durchaus haben, und Aschenputtel musste gerufen werden. Da wusch es sich erst Hände und Angesicht rein, ging dann hin und neigte sich vor dem Königssohn, der ihm den goldenen Schuh reichte. Dann setzte es sich auf einen Schemel, zog den Fuß aus dem schweren Holzschuh und steckte ihn in den Pantoffel, der war wie angegossen. Und als es sich in die Höhe richtete und der König ihm ins Gesicht sah, so erkannte er das schöne Mädchen, das mit ihm getanzt hatte, und rief: ,Das ist die rechte Braut‘.“
Autorin:
Als aber die bösen Schwestern zur Hochzeit erschienen, pickten ihnen die Tauben die Augen aus; und so waren sie für ihre Bosheit und Falschheit mit Blindheit auf ihr Lebtag geschlagen.
MUSIK
„Kinder brauchen Märchen“ heißt ein berühmter Buchtitel des Wiener Psychoanalytikers und Kindertherapeuten Bruno Bettelheim. Kinder brauchen Geschichten wie die vom Aschenputtel, weil es hier um ihre eigene Gefühlswelt geht. Es geht darum, dass Vertrauen aufkeimt, dass sich ihre Wachstumskräfte entwickeln, dass sie gestärkt werden für Konflikte, die zum Leben dazugehören.
Wie etwa der Konflikt zwischen konkurrierenden Geschwistern oder Gleichaltrigen. Aschenputtel kann sich der miesen Behandlung durch die Stiefschwestern äußerlich nicht widersetzen; sie muss Schikanen ertragen, aber das weckt in ihr eine verborgene Gegenkraft: Herd und Asche erinnern sie an früher, als ihre gute Mutter noch lebte. So findet sie zu dem tiefen, oft verschlossenen Gefühl verzweifelter Trauer um die tote Mutter und beginnt sich eigenständig innerlich zu entwickeln. Ein Kind, das diese Geschichte hört, wird an eigene Verlust-Erfahrungen herangeführt. „Früher hat Mama mich lieber gehabt, jetzt gibt es nichts als Stress und Ärger“ denken viele Kinder, die sich aus der frühkindlichen Geborgenheit herauslösen und auf den Weg ins eigene Leben machen.
Aschenputtel begießt aber mit seinen Tränen nicht nur das Grab der Mutter, sondern auch den Haselzweig, der zum Baum emporwächst. Ein wunderbares Bild für das neu erwachende Vertrauen. Gewiss: die Zeit vollkommener Geborgenheit ist vorbei; aber die Trauer ist nur ein Übergang. Das Verlorene wird zum inneren Besitz, zur inneren Kraft. Aschenputtel findet diese Kraft. Und darum ist es auch klüger als seine Schwestern. Das Märchen sagt: Innere Selbstgewissheit beruht darauf, dem Leben zu vertrauen und hängt nicht von äußerlichem Glamour ab. Die beiden Schwestern wissen davon nichts; sie suchen ihren persönlichen Wert im Äußerlichen, in Schmuck und Kleidern, die doch, wenn‘s drauf ankommt, nicht helfen können.
Unterdessen ist Aschenputtel gewachsen – wie der Haselbaum. Sie hat gelernt, dass es sich lohnt, durchzuhalten; wenn sie Linsen aus der Asche lesen muss. Was genauso wenig Spaß macht wie Hausaufgaben oder kleine häusliche Pflichten, die heutigen Kindern abverlangt werden. Und Aschenputtel lernt auch, gut und schlecht zu unterscheiden – damit grenzt sie sich ab von der bösen Stiefmutter und deren Töchtern, die ihre Macht über das Mädchen missbrauchen.
Wenn Aschenputtel schließlich doch zum Ball geht, so schön, dass es dem Königssohn auffällt, wagt sie sich aus der versteckten Lebensweise erstmals heraus. Es sind Versuche, sich in der Welt der Erwachsenen zu behaupten. Und zur Welt der Erwachsenen gehören Liebe und Erotik. Zweimal zieht das Mädchen sich wieder zurück, bis der Königssohn es beim dritten Mal zur Anprobe des Pantoffels nötigt: und da zeigt sich Aschenputtel, so, wie sie in Wirklichkeit ist: keine strahlende Prinzessin, sondern ein Mädchen, das in seinem schmutzigen Kleid aus dem Holzschuh in den Goldpantoffel schlüpft. Dass ihr Fuß genau passt, deutet an: die beiden, Aschenputtel und der Königssohn, passen in jeder Hinsicht zueinander und können ein glückliches Paar werden.
Die beiden Schwestern werden mit Blindheit bestraft: aber sie hatten ja die ganze Zeit schon Augen nur für das, was eigentlich nichts zählt.
Deswegen lieben eigentlich fast alle Menschen jeden Alters Märchen: eben weil die unausgesprochenen Botschaften einer solchen Geschichte tröstlich und ermutigend sind: Streit gibt es; aber davon wirst du nicht zerstört. Sich schmutzig zu machen, ruiniert nicht zwangsläufig das ganze Leben. Durchhalten lohnt sich; das Äußere entscheidet nicht über deinen Wert. Um weiterzukommen, musst du vielleicht viel aushalten und dich anstrengen, vor allem musst du lernen, Gutes und Böses zu unterscheiden; aber Ende wirst du gutes Neuland betreten.
MUSIK
Autorin:
Nicht nur Kinder brauchen Märchen, wenn Krisen auftauchen, schwierige Aufgaben zu lösen sind oder Schicksalsschläge verkraftet werden müssen. Märchen geben keine einfache oder eindeutige Antwort. Aber sie erzählen von verborgenen Kräften, die im Menschen stecken; und sie helfen, diesen Kräften zu vertrauen.
Im Leben Bruno Bettelheims, der das Buch „Kinder brauchen Märchen“ verfasst hat, gab es immer wieder Erfahrungen und Wechselfälle, die in den Märchen symbolisch erzählt werden. Etwa das Glück der Geborgenheit, das Menschen mutig und neugierig aufs Leben macht. So wuchs Bruno Bettelheim in behüteten Verhältnissen einer wohlhabenden Wiener Familie auf und wurde ein bekannter Kindertherapeut. Mit dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland endete diese Lebensphase jedoch abrupt. Er wurde, wie viele andere österreichische Juden, verhaftet und ins KZ verschleppt – erst nach Dachau, dann nach Buchenwald. Umgeben von Tod und Angst, Misshandlungen und Demütigungen schuf Bettelheim sich eine Lebensaufgabe. Er fing an, in Gesprächen mit seinen Leidensgenossen herauszufinden, wie Menschen sich unter solch grausamen Bedingungen verändern, und was ihnen zum Überleben hilft. Diese geistige Auseinandersetzung mit dem Grauen, das ihn umgab, half ihm, sich nicht aufgeben zu müssen und sich eine Art innerer Distanz vom Leben im KZ bewahren zu können.
Eine glückliche Begegnung half weiter: in Wien hatte Bettelheim einst zusammen mit seiner Frau ein autistisches Kind amerikanischer Eltern zu sich genommen und ihm behutsam geholfen, aus der vollständigen Isolation herauszufinden. Die Frau Bruno Bettelheims war mit diesem Kind glücklicherweise rechtzeitig in die USA geflüchtet. Von dort aus wurde nun Bettelheims Freilassung betrieben, die ihn schließlich aus dem KZ rettete.
In manchen Märchen gibt es das: dass der Held, ohne an einen persönlichen Nutzen zu denken, einem Tier oder einer Pflanze hilft – und später von diesem Wesen aus Dankbarkeit gerettet wird. In manchen Märchen und in manchem, nicht in jedem Leben kann sich das ereignen. Doch Märchen geben solchen Erfahrungen mit ihrer bildhaften Sprache eine Gestalt. Damit machen sie Hoffnung und leiten an, jeden Tag hilfsbereit und achtsam gegenüber der Mitwelt zu sein.
Auch ein weiteres Märchenmotiv entspricht einer Erfahrung Bettelheims: dass sich ein Held bewähren und viele Proben bestehen muss, bevor er sich durchsetzt. Denn zunächst hielt man in den USA seine in Dachau und Buchenwald gesammelten Beobachtungen für übertrieben, ja sogar für unglaubwürdig. Aber bei Kriegsende wurden seine psychologischen Schlussfolgerungen anerkannt und in den Rang einer Pflichtlektüre für amerikanische Offiziere erhoben.
In Bruno Bettelheims Leben spiegelt sich, dass Märchen ehrlich sind. Was Menschen Böses widerfährt und was sie selbst Böses tun, wird nicht beschönigt. Dass es dennoch am Ende oft heißt: „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch immer“, veranschaulicht den vertrauensstärkenden Grundzug so vieler Märchen. Das eigene Leben im Spiegel eines Märchens zu lesen hilft, dort Wege ins Offne und neue Zuversicht zu entdecken, wo sonst der nüchterne Blick einem den Mut und die Hoffnung rauben möchte. So gesehen sind Märchen für Kinder und Erwachsene erzählte Lebenshilfe.
MUSIK
Autorin:
Bruno Bettelheim, der geniale Ausleger, verstand Märchen als Lebenshilfe – nicht nur für Kinder. Ganz andere Motive waren es, die Jakob und Wilhelm Grimm bewegten, als sie vor 200 Jahren den ersten Teil ihrer „Kinder- und Hausmärchen“ herausbrachten. Ihnen ging es um die deutsche Poesie. Die mündlich überlieferten Märchen sollten nicht in Vergessenheit geraten; darum veröffentlichten die beiden einen Aufruf, Märchen aufzuschreiben und ihnen zugänglich zu machen. Und sie lauschten auch Nachbarn und Bekannten Märchen ab. Besonders der stilistisch unverwechselbare „Märchenton“, eine sprachliche Schöpfung besonders Wilhelm Grimms, sorgte rasch für deren Verbreitung. Das berühmte „Es war einmal“ macht bis heute Alt und Jung empfänglich für die im Märchen bewahrte Weisheit und Lebenswahrheit.
Für mich ist es kein Zufall, dass sich solch märchenhafte Lebenswahrheit unmittelbar im Lebensschicksal der Brüder Grimm widerspiegelt. Die beiden hatten früh den Vater verloren und lernten in der Kindheit schon Armut und sparsames Haushalten kennen. In Kassel, wo ihnen fremde Gönner Schule und Studium ermöglichten, lebten sie in kärglichen Verhältnissen – immer in der festen Überzeugung Wesentliches zu leisten: mit ihren Forschungen zur Geschichte der deutschen Sprache, zur Überlieferung der Sagen und Märchen sowie zur Entstehung des Deutschen Rechts. Als sie endlich ein sicheres Auskommen an der Göttinger Universität gefunden hatten, protestierten sie aus Gewissensgründen gegen den Verfassungsbruch des selbstherrlichen Königs von Hannover. Das kostete sie ihre Stelle. Als Mitglieder der berühmten aufrechten „Göttinger Sieben“ wurden sie des Landes verwiesen und kehrten nach Kassel zurück. Nach drei Jahren, in denen sie sich zurückgezogen bei knappem Lebensunterhalt ihrer Arbeit am deutschen Wörterbuch widmeten, bot sich ihnen endlich in Berlin eine ihrer internationalen Berühmtheit angemessene Stellung.
Ein märchenhafter Ab- und Aufstieg und ein dem Geist der Märchen entsprechender Mut zeichnet die beiden Brüder aus! Ihrem Durchhaltevermögen und Forscherdrang verdankt sich auch ihre einzigartige Märchensammlung. Diese Sammlung ist für mich die kleine, jüngere Schwester der Bibel. Unsere Religion hat viele Wege, unser Herz zu erreichen. Zu ihnen gehören ohne Zweifel auch Grimms Märchen mit ihrem kraftvollen, lebensnahen Bilderreichtum, der unser Lebensvertrauen stärkt. Der Ehrentitel, den Martin Luther der Bibel verliehen hat, gilt somit auch ihnen: sie sind kein Lesebuch, sondern ein Lebensbuch!
MUSIK