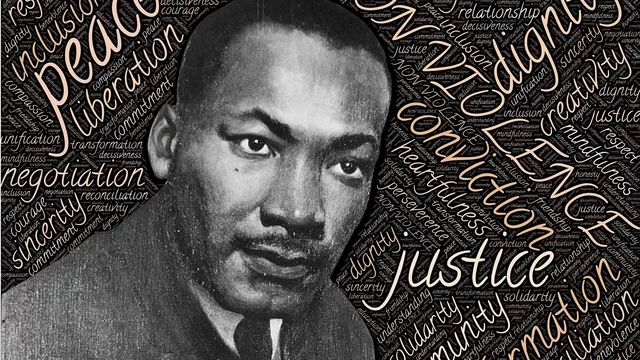Heimat ist etwas, das ich mache
Wer anfängt, heute, im 21. Jahrhundert, über den Begriff „Heimat“ nach zu denken, der verliert schnell den festen Boden unter den Füssen.
Dabei war doch gerade dies, nämlich der feste Boden unter den Füssen, einmal die Keimzelle des Heimatverständnisses. Die eigene Scholle, Haus und Hof, der Ort, in den man hineingeboren war, seine Landschaft, seine Sitten und Gebräuche – darüber wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein Heimat definiert.
Ein statischer Begriff, auf Besitz und Zugehörigkeit gegründet, der für eine wohlbegründete, umzäunte Welt stand. Hinterm Horizont begann die Fremde, zu der allenfalls Kriegsleute, Handelsherren, vielleicht noch Adel und Klerus Beziehungen unterhielten.
Ausdruck dieser engen Welt ist der Begriff Kirchturmspolitik. Nur was im Nahbereich von Nutzen war, wurde auch gewollt. Als sich die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert international vernetzte, trug diese Weitsicht ihren Mitgliedern nicht etwa Ansehen ein, sondern das Gegenteil: die Abwertung als vaterlandslose Gesellen.
Das 20. Jahrhundert hat den alten Heimatbegriff aufgesprengt. Das Dritte Reich, das den Begriff der heimatlichen Scholle noch einmal hoch hielt, endete damit, das Millionen aus ihrer Heimat vertrieben wurden und sich in unvertrauter Umgebung, nur mit einem Koffer in der Hand, neu beheimaten mussten.
Heute, im Zeitalter der Globalisierung, sind es die Karriere-Nomaden, die Arbeits-Migranten und die Asylsuchenden aus aller Herren Länder, denen diese Aufgabe abverlangt wird.
Wer die Heimat aufgibt, aufgeben muss, für den wird Heimat zur Aufgabe. Zu etwas, das ich mache.
Nur, wie macht man Heimat? Ein Schulfach ist das nicht. Aber eine vielfach erprobte und unterschiedlich ausgestaltete Praxis.
Ich nehme mal meinen Freund Hartmut, einen Arzt aus Norddeutschland, der, als er 60 wurde, seine Praxis verkauft und in die Vereinigten Staaten übersiedelte. Er hatte dort eine Frau kennengelernt, mit der er sein Leben fortsetzen wollte. Hartmuts Schwestern waren entsetzt. Du weißt doch, sagten sie, dass du in den Staaten in deinem Beruf nicht mehr arbeiten kannst. Wie willst dann dort noch heimisch werden? Wie kannst du mit Sechzig dein schönes Haus aufgeben, die Nähe zu Kindern und Enkeln, deinen Freundeskreis in der Stadt, in der Du 30 Jahre gelebt hast? Du wirst es bitter bereuen.
Doch der Bruder strafte alle Unkenrufe Lügen. Er übersiedelte in die Staaten, heiratete und trat als erstes in einen Chor ein, einen Gospel-Chor, der aber auch europäische Kirchenmusik sang. Er optimierte sein Englisch, ging mit den Nachbarn schwimmen, bot Chi-Gong und Yoga-Kurse an. Und als zwei Jahre später für das lokale Altersheim ein sogenannter Ombudsmann gesucht wurde, also einer, der zwischen den Bewohnern, dem Pflegepersonal, der Leitung und den Ärzten vermittelt, bewarb er sich um dieses Ehrenamt und lernt seitdem die sozialen Milieus seines Gastlandes aus mehr als nur einer Perspektive kennen. Drei Jahre später beantragte er die amerikanische Staatsbürgerschaft. Der Ausgewanderte war in der neuen Heimat angekommen, indem er sich in ihre sozialen Strukturen eingeklinkt hatte.
Im Vernetzt-Sein mit einer Gruppe liegt ein wesentliches Fundament für das Gefühl der Beheimatung. Mancher ist da schon mit einem Chatroom im Internet zufrieden. Andere nutzen die zahlreichen Vereine als Entree. Und wieder Andere haben die Kirchengemeinden als Portal zur neuen Beheimatung entdeckt. Keine schlechte Adresse. Die Leute, die man dort trifft, sind irgendwie alle Richtung Heimat unterwegs und freuen sich über jeden, der mitwandert.