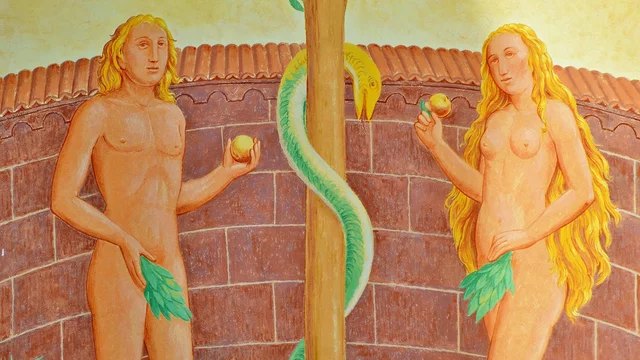17. Juni - Tag der Deutschen Einheit?
Ein paar Dinge über Deutschland waren mir schon als Kind klar: In den Burgen, die man noch sehen kann, haben früher Ritter gelebt. Wir leben in einem freien Land und dürfen wählen gehen. Es gab mal zwei große Kriege. Aber was ich ehrlich gesagt – ich bin nämlich 1993 geboren - erst später gemerkt hab: Dass Deutschland mal geteilt war. Ich sehe sie noch vor mir, und vielleicht gibt es sie auch immer noch im Keller meiner Eltern: die Karte von Deutschland, die gleichzeitig ein Puzzlespiel ist. Es ist nicht besonders herausfordernd, es sind nur wenige Teile. Die alten Bundesländer sind jeweils bunte Teile, die DDR ist ein großer, schmutzig-gelber Klotz. Aus heutiger Perspektive ist sogar die Farbwahl schon bezeichnend. Wenn ich mich empört habe: „So sieht Deutschland aber gar nicht aus!“, habe ich als Antwort bekommen: „Heute nicht mehr, aber es ist noch nicht lange her, da war das so.“ Und das hat ja auch gestimmt, denn diese Frage habe ich allerspätestens in den frühen 2000ern gestellt.
Die Bedeutung dieses Gedenk-Tages war mir nicht klar
Als Kind war mir klar: Wir leben in einem Land, es sieht ungefähr so aus, es geht vom Meer bis zu den Alpen und von Sachsen bis zum Saarland. Die Mauer ist weg, die Teilung vorbei, die Welt in Ordnung. Über den „Tag der Deutschen Einheit“ habe ich mir kaum Gedanken gemacht, da war schulfrei und das war ja super. Im Herbst gibt es ja eh nicht so viele Feiertage. Aber eine Sache hat mich immer wieder nachhaltig verwirrt: Auch im Juni hat meine Mutter immer vom Tag der Deutschen Einheit geredet. Und wenn ich dann nachgefragt habe, hat sie mir von einem Volksaufstand erzählt mit vielen Toten, wo Menschen von Panzern bedroht wurden. Das hat bei mir das gleiche eklige Gefühl in der Magengrube verursacht, wie wenn es um den Zweiten Weltkrieg ging oder die Gewaltherrschaft der Nazis und den Holocaust, das Wort Schoah kannte ich damals noch nicht.
Die Vorstellung, Deutschland sei überall gleich, ist naiv
Meine Mutter hat immer bedauert, dass der 17. Juni kein arbeitsfreier Tag mehr ist und es kaum mehr Aufmerksamkeit für das Datum gibt. Als Kind und als Jugendliche konnte ich das Problem nicht verstehen. Es gab den Staat ja nicht mehr, der bereit war, auf seine Bevölkerung zu schießen. Das Land war ja geeint und alles wieder gut. Erst in den letzten Jahren habe ich angefangen zu verstehen: So einfach ist es nicht. Und die Vorstellung ist naiv, Deutschland sei überall gleich und die Spuren der Trennung verschwunden.
Musik
Solche Menschen werden für mich zum Augenöffner
In meinem Alltag zu Hause und auch bei der Arbeit begegne ich immer wieder Menschen, die aus einem Teil Deutschlands in einen anderen umgezogen sind. Diese Menschen werden für mich oft zum Augenöffner. Da ist der Kommilitone aus Berlin, der mir einmal erzählt hat, dass er mit Kindern aus dem Ost- und dem Westteil der Stadt zur Schule gegangen ist, und er hatte immer das Gefühl, in Sachen Sozialkompetenz und Zusammenhalt haben die ostgeprägten Kids die Nase vorne. Da gab es einen Dozenten für Kirchengeschichte, der in beiden Teilen Deutschlands gelebt und gearbeitet hat und uns dafür sensibilisieren wollte, wie anders Kirche in einer Diktatur funktionieren musste und wie stark die Mentalitätsunterschiede bis heute sind – und dass sich Seelsorgende unbedingt darauf einstellen müssen, mehr noch, als sie sich sowieso schon immer an ihre Zielgruppe anpassen sollten. Dann gibt es die vielen kleinen Unterschiede, zum Beispiel, dass die Westente meiner Kindheit Quak quak macht, die Ostente aus der Kindheit meines Thüringer Freunds aber Naak naak – eben wie Schnatterinchen. Oder dass ich, wenn ich „Bauer“ sage, immer an einen selbstständigen Landwirt mit Familienbetrieb denke, er an einen Arbeiter einer LPG.
Hier sind wir die Ossis, - dort, die in den Westen gezogen sind
Ich will das hier nicht künstlich aufbauschen, aber ich lerne immer wieder dazu und manches ein bisschen besser verstehen. Ich denke in letzter Zeit oft an etwas, das mir die Mutter eines Kommunionkinds gesagt hat. Wir haben Fürbitten für den Festgottesdienst der Kinder vorbereitet und sie meinte: „Es fehlt noch eine für die Heimatlosen.“ Ich habe zurückgefragt: „Meinst du wohnungslose Menschen?“ und habe dann direkt die kindgerechte Variante hinterhergeschickt: „Menschen, die kein Zuhause haben?“ Aber sie meinte all die, die das Gefühl haben, nirgendwo so ganz dazuzugehören. „Hier sind wir die Ossis, dort sind wir die, die in den Westen gezogen sind.“ Von Menschen mit Migrationshintergrund habe ich das ja schon gehört, aber von jemandem, der innerhalb Deutschlands umgezogen ist?! Da musste ich erstmal schlucken.
Musik
Unser Land war länger geteilt, als wieder vereint
All diese Augenöffner – und Augenöffnerinnen, die mir begegnen, bringen mich zum Nachdenken. Immer wieder verändert sich mein Bild vom geeinten Deutschland, von Ost und West und mittlerweile ist mir nur noch eins richtig klar: Es ist kompliziert. Der 17. Juni als Tag der Deutschen Einheit war damals ja nicht dafür da, die erreichte Einheit zu feiern. Er war Mahnmal der Teilung und Hoffnung auf die Zukunft. Heute ist die Einheit nominell erreicht. Aber an vielen Stellen ist die Teilung noch deutlich zu spüren. Das Land war ja auch länger geteilt, als es jetzt wieder vereint ist. Zum Zurücklehnen ist es also noch zu früh, es gibt noch viel zu tun. Aber was könnte man denn tun? Es wird ziemlich sicher nicht helfen, sich von hier aus vor Wahlergebnissen zu fürchten oder auf Menschen als unaufgeklärt oder rückschrittlich herunterzuschauen. Es wird auch nicht helfen, so zu tun, als wäre alles gut und es gäbe kein Problem. Mir scheint, das einzige, was hilft, ist, wie so oft: einander zuzuhören. Sich kennenzulernen. Vielleicht ein Schüleraustausch zwischen Ost- und Weststädten. Vielleicht einfach mal ein Urlaub im Erzgebirge oder an der Ostsee, im Harz oder an der Seenplatte. Vielleicht ein Besuch an den großen Stätten gemeinsamer Deutscher Geschichte, in Weimar, der Wiege unserer ersten Demokratie, oder in den großen Pfalzstädten in Sachsen-Anhalt, die all die Ottos und Karls vor 1000 Jahren schon so geschätzt haben.
Ich kann nicht bestimmen, was für andere gut ist
Das sind lauter Vorschläge für Menschen wie mich, die im Westteil Deutschlands sozialisiert wurden. Für die Menschen in den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern mache ich lieber keine, denn auch das ist etwas, was bestimmt hilft: nicht darüber entscheiden wollen, was für jemand anderen gut und richtig ist.
Uns mit der Geschichte beider Deutschlands beschäftigen
Einige Dinge können wir aber auch gemeinsam tun. Der 17. Juni kann eine Chance sein, sich mit der Geschichte unserer beiden Deutschlands zu beschäftigen. Und zwar mit dem Forschungsstand heute. Nicht mit der Propaganda, die egal welche Seite daraus gemacht hat. Es ist eine Chance, gemeinsam stolz zu sein auf den Mut der Frauen und Männer, die sich damals 1953 eingesetzt haben für erträgliche Arbeitsbedingungen, für eine gesicherte Grundversorgung für sich und ihre Kinder, aber auch für freie, gleiche und geheime Wahlen, für eine Absetzung der Regierung und die Befreiung politischer Gefangener. Und wir können uns gemeinsam ins Gedächtnis rufen, was auf dem Spiel steht, wenn die Demokratie beschädigt und die Gewaltenteilung ausgehebelt wird, wenn Menschen- und Bürgerrechte nicht mehr gewährleistet und geschützt werden.
Wir sind verschieden, haben aber alle die gleiche Würde
Für mich ist das nicht nur als Bürgerin unseres Staates wichtig, sondern auch als Christin. Ich glaube an einen Gott, der jeden Menschen als sein Geschöpf liebt, der geplant hat, dass wir alle verschieden sind, aber die gleiche Würde und den gleichen Wert haben. Und der will, dass wir so frei wie möglich sind, frei von Abhängigkeiten und frei, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, es so zu gestalten, dass es uns und allen Menschen gut geht. Und das gelingt am besten in der Freiheit der Demokratie und im Frieden einer diversen, aber geeinten Gesellschaft, davon bin ich überzeugt.