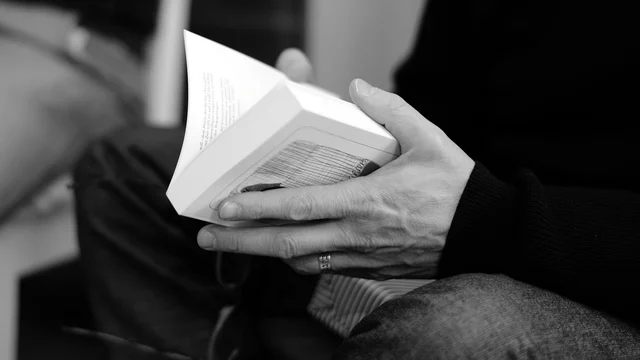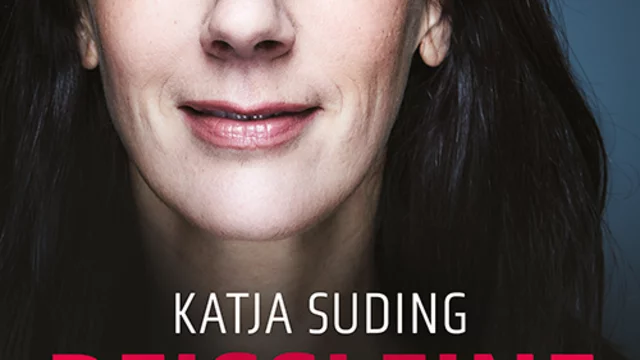Gut gegen Böse
I
In Nordirland tobte 1976 der Bürgerkrieg zwischen Katholiken und Protes-tanten, der eigentlich einer zwischen den katholischen Iren und protestantischen Briten war, und schon seit Jahrhunderten schwelte. Am 10. August 1976 versuch-ten in Belfast zwei irische Untergrundkämpfer zu entkommen. Auf der Flucht, bei einem Schusswechsel mit britischen Soldaten, erfasste ihr Auto eine Frau und ihre drei kleinen Kinder, darunter ein Baby. Die Mutter überlebte schwer verletzt, alle drei Kinder starben.
Das sah eine Nachbarin namens Betty Williams. Sie war geschockt, und auf der Stelle fasste sie den Entschluss, etwas gegen diese nicht enden wollende, sinnlose Gewalt in ihrem Land zu unternehmen. Sie ging sofort von Haus zu Haus, um ihre Nachbarn aufzurütteln. Sie gründete die Aktionsgruppe Women for Peace, Frauen für den Frieden. Auf der Beerdigung traf sie die Tante der drei getöteten Kinder, und einen Journalisten. Die zwei wurden ihre Mitstreiter. Als Betty Williams am Tag darauf zu Demonstrationen gegen den Bürgerkrieg aufrief, versammelten sich bereits 10.000 Menschen. Im Fernsehen wurde über ihr Engagement berich-tet, über ihren Aufruf gegen Gewalt und für Versöhnung. Innerhalb kürzester Zeit erlebte sie eine gewaltige Unterstützungswelle. Einige Tage nach der Beerdigung verfasste Betty Williams mit ihrem Team die Declaration of Peace People, die Er-klärung der Friedenswilligen. Sie bestand aus wenigen, einfachen Sätzen. Zum Beispiel:
Wir wollen leben und lieben und eine gerechte und friedliche Gesellschaft aufbau-en. Wir lehnen die Bombe und die Kugel und alle Techniken der Gewalt ab. Wir erkennen an, dass uns der Aufbau eines solchen Lebens harte Arbeit und Mut ab-verlangt.
Kurze Zeit später gab es Friedensdemonstrationen mit einer halben Million Menschen in ganz Großbritannien und Nordirland. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Nordirlandkonflikt in seinem siebten Jahr. Rund 1600 Menschen hatten bereits ihr Leben verloren, und die bisherigen, kleineren Friedensbewegungen hat-ten selten mehr als einige Tausend Menschen aktivieren können.
Ein Jahr später bekam Betty Williams den Friedensnobelpreis. Als beein-druckendes Beispiel dafür, wie Menschen dem Bösen entgegentreten können. In-dem sie nicht mehr mitmachen bei der üblichen Ausgrenzung und Gewalt gegen Andere. Albert Schweitzer, ebenfalls Friedensnobelpreisträger, hat gesagt: Das gute Beispiel ist nicht nur eine Möglichkeit, andere Menschen zu beeinflussen, es ist die Einzige.
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Dies Wort ist zur Jahreslosung 2011 gewählt worden. Also zu einer Art Motto-Satz für die Christen hierzulande. Eine ziemliche Herausforderung. Denn: wie kriegt man das hin, so wie die Frauen in Nordirland?
II
Ein Mann rennt, ohne sich umzuschauen, aus einem Hauseingang und prallt fron-tal gegen einen anderen. Jetzt wird er auch noch furchtbar wütend wegen dem lästigen Zusammenstoß. Er schreit und beleidigt den Passanten.
Der Angerempelte wartet einen Augenblick, schaut freundlich und sagt: „Ich weiß nicht, wer von uns schuld hat. Ich will meine Zeit auch nicht mit dieser Frage vergeuden. Deshalb: Wenn ich schuld bin, dann verzeihen Sie mir bitte, dass ich nicht aufgepasst habe. Falls Sie schuld sind, soll es für mich keine Rolle spielen. Vergessen sie den Vorfall einfach, und lassen sie sich nicht aufhalten.“
Dann lächelt er noch mal, geht, und lässt den überraschten Rempler im Hausein-gang zurück. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, sagt die Bibel. Aber wie kriegt man das hin, nicht zurück zu schreien, nicht zurück zu schlagen, nicht Gleiches mit Gleichem zu beantworten? Wahrscheinlich nicht mit edlem Heldenmut. Denn der ist nicht so weit ver-breitet. Wohl eher mit der Einsicht, dass Gewalt nichts bringt. „Auge um Auge – und die ganze Welt wird blind sein.“ sagte Mahatma Gandhi. Es gibt eine Spirale des Bösen. Um nicht mitgerissen zu werden, muss man aussteigen.
Martin Luther King, der amerikanische Pastor und Bürgerrechtler, hat es so ausgedrückt: „Die ultimative Schwäche der Gewalt ist, dass sie eine abwärtsge-richtete Spirale ist, die genau das erzeugt, was sie zu zerstören sucht. Statt das Böse zu verringern, multipliziert sie es. Durch Gewalt kann man zwar den Lügner ermorden, jedoch nicht die Lüge... Durch Gewalt kann man zwar den Hasser er-morden, jedoch nicht den Hass. Im Gegenteil: Gewalt erzeugt nur noch mehr an Hass... Dunkelheit kann keine Dunkelheit vertreiben, nur Licht vermag das. Hass kann keinen Hass vertreiben.“
Dieses Licht, dieses Gute, müssten Christen eigentlich kennen. Denn es ist Gottes Liebe zu allen. Selbst zu den Bösen. Der Apostel Paulus schreibt: Gott er-weist seine Liebe zu uns darin, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, Feinde Gottes.
Jesus ging an benachteiligten Menschen nicht vorbei. Er half ihnen auf. Und selbst wenn ihm missfiel, was sie taten, so hat er sie nicht verachtet. Einem korrupten Steuereintreiber der Besatzungsmacht begegnete er mit Liebe. Er ging mit ihm essen. Das Gleiche machte er mit Kriminellen, Asozialen und Kranken.
Die Liebe zu jedem war sein Markenzeichen. Das war sicher nicht leicht. Denn Judas hat ihn verraten und Petrus hat ihn verleugnet. Er wollte, dass auch seine Nachfolger nicht sagen „wie du mir, so ich dir“, sondern: „wie Gott mir, so ich dir“.
Dennoch frage ich mich, ob ich das wirklich auf meine Konflikte übertragen kann.
III
Es gibt Kräfte in mir, die miteinander streiten. Und oft gewinnt das Böse. Dann such ich Gelegenheiten für meine Rache. Oder ich breche einen Kontakt für im-mer ab. Oder ich fange an, jemanden schlecht zu machen bei anderen. Aber, muss das immer so sein? Wie kann ich beginnen, anders zu reagieren?
Zum Glück fängt ja alles klein an. So wie z.B. in Nordirland. Wie haben es die peace people zusammen mit Betty Williams gemacht? Sie haben bei ihrem Nachbarn, der einer anderen Konfession angehörte, begonnen. Mit Kontakt, mit Reden. Sie hörten auf mit Urteilen und Zurückschlagen. Sie hörten auf, andere zu bekämpfen. Auch wenn sie nicht wussten, was daraus wird. Sie konnten nur dar-auf bauen, dass die Sehnsucht nach Frieden auch bei den anderen da ist.
War Betty Williams vielleicht besonders begabt für so was? Eigentlich nicht. Sie hatte in ihrem Leben nur viel sinnloses Leid erlebt. Schon ihr protestantischer Opa wurde gemobbt, weil er eine Katholikin geheiratet hatte. Die Ehe ihrer Eltern, und ihre eigene, litten auch unter unterschiedlichen Kirchenzugehörigkeiten. Zwei ihrer Cousins wurden auf offener Straße getötet. Einer von der evangelischen, iri-schen Befreiungsbewegung, der andere von der katholischen.
Als Betty Williams dann aus nächster Nähe den Tod ihrer drei Nachbarskinder mit ansehen musste, da gab sie ihr unpolitisches Leben auf und fing an zu handeln.
So begann es.
In ihrer Rede zur Verleihung des Friedensnobelpreises sagte sie: „Mitgefühl ist wichtiger als Intellekt, um die Liebe hervorzurufen, die die Friedensarbeit benö-tigt,…wenn wir kein Mitgefühl haben, …werden wir den Kampf sehr wahrschein-lich nur über Theorien führen.“
Nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 war allerdings auch Betty Williams erste Reaktion der Ausruf: Nuke them! Das bedeutet: Macht sie fertig! Vernichtet sie! Das hatte Betty Williams bei einer Vorlesung an der Universität von Miami zugegeben. Trotzdem führte sie dann aus, warum selbst hier die Reaktion keinesfalls gewaltsam sein dürfe. Ein nachhaltiger Kampf gegen den Terrorismus sei nur zu gewinnen, wenn er nicht mit den gleichen Mitteln geführt würde.
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Als Teenager wohnte ich eine Zeit lang in Altena, Westfalen. Auf meinem Schulweg war ein Händler, der meist Obst- und Gemüsekisten vor seiner Tür ste-hen hatte. Zusammen mit mir kamen da jeden Morgen scharenweise Schüler vor-bei. Viele drängelten sich in den Laden, um Essbares für den Vormittag zu kaufen. Aber einige klauten auch. Und scheinbar wurde das zum Sport. Nach einiger Zeit verdächtigte der Händler misstrauisch jeden Schüler. Zwischendurch kam er sogar überraschend hinter der Theke hervor und griff verdächtigen Jungen oder Mäd-chen in die Taschen. Alles ohne Erfolg.
Aber eines Tages hatte er wirklich eine Überraschung parat. Er saß freund-lich vor seinem Laden zwischen den Kisten, und bot jedem Schüler der vorbeikam, ein Obststück an. Gratis! Dabei wünschte er uns einen guten Schultag und meinte, wir sollten morgen wieder vorbei kommen.
Ich habe nicht nachgefragt, ob anschließend nicht mehr geklaut wurde. Ich weiß aber, dass wir auf dem Schulhof sehr anerkennend über ihn geredet haben. Er galt ab da als eine Art Verbündeter, auf den wir nichts kommen ließen.