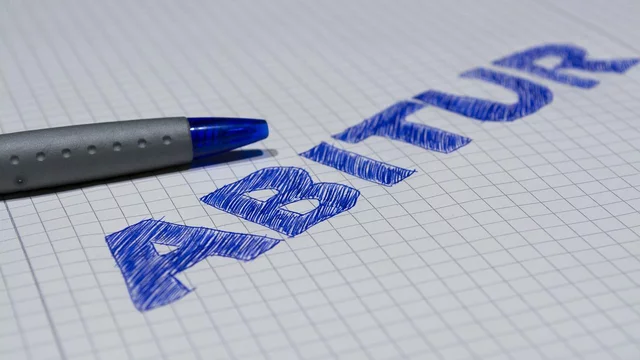Iznik - Wo das Glaubensbekenntnis herkommt
Was hat eine kleine Stadt in der Türkei mit dem christlichen Glauben zu tun? Die Reise von Autor Matthias Viertel nach Iznik führt zurück zu den Wurzeln des Glaubens – an den Ort, an dem vor 1700 Jahren die Kirche ihren Anfang nahm.
Eine Kleine Stadt mit einer besonderen Geschichte
Iznik ist eine kleine Stadt im Nordwesten der Türkei, die von Touristen aus dem Westen nur selten beachtet wird. Ich hätte mich wohl nicht auf den langen Weg gemacht, wenn da nicht die besondere Geschichte dieser Stadt wäre. Und die führt immerhin genau 1700 Jahre zurück und betrifft sogar den Kern des christlichen Glaubens. Die Reise geht zunächst nach Istanbul, von dort kurz mit der Fähre über das Marmara-Meer nach Yalova und die letzte Etappe mit dem Bus bis Iznik, das Ziel der Reise.
300 Jahre nach Christus hieß die Stadt noch nicht Iznik, sondern Nicäa. Das war der Ort, an dem das erste Konzil der Christen stattgefunden hat. Ein Konzil ist eine Versammlung überwiegend von Bischöfen, auf der wichtige Fragen des Glaubens geklärt werden. Beim Bummel durch die Gassen der Altstadt macht sich diese Geschichte noch immer bemerkbar. Es ist wie in einem Freiluftmuseum: Hier Reste der alten Stadtmauer, dort ein antikes Tor, und schließlich das große römische Theater.
In der Kirche Hagia Sophia wurde über die Grundlagen des christlichen Glaubens diskutiert
Ein Gebäude erregt meine Aufmerksamkeit besonders: Es ist die Kirche Hagia Sophia aus dem 4. Jahrhundert, sie ist das älteste Gebäude der Stadt. Hier, an dieser Stelle, versammelten sich auf Einladung des Kaisers die geistlichen Würdenträger der ganzen Welt, soweit sie damals bekannt war. Hier saßen sie zusammen, diskutierten über die Grundlagen des christlichen Glaubens und rangen bei strittigen Fragen um Kompromisse. Dieser Ort des ersten christlichen Konzils ist so etwas wie die Wiege der Kirche.
Der christliche Glaube hat seine Quelle in Galiläa und Jerusalem. Er ist untrennbar mit dem Wirken Jesu verbunden. Aber um das herauszubilden, was wir heute als Kirche bezeichnen, waren ein paar hundert Jahre erforderlich. Damals, ganz an den Anfängen der Kirche, musste abgewogen werden, wie die Ereignisse der Evangelien gedeutet werden. Es gab unterschiedliche Haltungen und manche konfliktträchtige Frage musste sich klären. Genau dafür war dieser Ort Nicäa und die Zusammenkunft der Bischöfe so bedeutend, dass man tatsächlich sagen kann: Hier in Iznik, damals Nicäa, nahm die weltweite Kirche der Christen ihren Anfang.
Musik 1: Raqes, Ahoar - Between Rivers (Dietmar Fuhr, Bassem Hawar, Free Desmyter, Saad Thamir)
Der Ort, an dem die weltweite Kirche der Christen ihren Anfang nahm
Das hatte mich auf die Idee gebracht, nach Nicäa zu reisen, beziehungsweise nach Iznik, wie die Stadt heute heißt: Der Wunsch, einmal an dem Ort zu stehen, an dem so vieles besprochen und geklärt wurde, was bis heute den christlichen Glauben prägt. Und klar, der Besuch der Kirche ist das wichtigste Ziel der Reise.
Es ist nicht schwer, den Weg zu finden. Trotz meiner Verständigungsprobleme zeigen mir die Menschen bereitwillig die Richtung und murmeln etwas wie Ayasofya Orhan Camii. Cami ist der Ausdruck für eine Moschee. Und tatsächlich stehe ich auf einmal vor dieser altehrwürdigen Kirche aus dem vierten Jahrhundert, die nun aber ein Minarett anstelle des Kirchturms hat.
Aus der Kirche wurde eine Moschee: Bis heute
Fast tausend Jahre wurden hier christliche Gottesdienste gefeiert. Dabei kam es wiederholt zu baulichen Veränderungen, einmal wurde die Hagia Sophia durch ein Erdbeben beschädigt, konnte aber wieder hergestellt werden. Später eroberten die Osmanen die Stadt. Sultan Orhan wandelte die Kirche damals in eine Moschee um, und ersetzte den Glockenturm durch ein Minarett. Zwar wurde die Moschee 1935 von der laizistischen türkischen Regierung in ein Museum umgewandelt, aber dabei blieb es nicht. Inzwischen ist die Hagia Sophia erneut zur Moschee erklärt worden. Übrigens nicht ohne Protest.
Am Eingang sitzen ein paar Männer, die mir gerne Auskunft geben. Sie berichten von dem Einspruch, den die Stadtverwaltung gegen die Umwandlung in eine Mosche eingebracht hatte. Sie erwähnen Gürhan Akdoğan, einen kommunalpolitisch engagierten Ingenieur, der „die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee als den schwersten Schlag für den Tourismus in Iznik“ bezeichnet[i]. Hier befürchten viele eine Einbuße für den Fremdenverkehr, wenn der für die Christen so symbolträchtige Ort wieder als Moschee genutzt wird.
Immerhin darf ich in das Gebäude gehen und mich umsehen. Allerdings mit dem nachgeschobenen Hinweis, besser kein Lied zu singen und das Gebet, wenn mir danach ist, lieber im Stillen zu verrichten. Der Eindruck im Inneren ist überwältigend: Zwar sind die einst so prächtigen Wandmalereien verschwunden, hier und da finden sich Reste der Mosaiken und Fresken. Dafür ist der Boden mit Gebetsteppichen ausgelegt. Aber ganz vorne, in der Apsis, entdecke ich eine aus Steinen im Halbkreis geformte Stufenbank, auf der einst die Priester Platz genommen hatten. Die Ausstrahlung der antiken Mauern ist groß, in Gedanken stelle ich mir vor,, wie es damals im Jahr 325 gewesen sein könnte, als die Geistlichen zum ersten Konzil der Christenheit auftraten.
Musik 2: Traditional, The Fall of Constantinople, Capella Records 2006 (Capella Romana, Alexander Lingas)
Eine illustre Gesellschaft war da in Nicäa zusammengekommen vor genau 1700 Jahren. Genau genommen fand die Versammlung in der kaiserlichen Sommerresidenz statt, von der es heute keine Spuren mehr gibt. Die ursprüngliche Hagia Sophia aus dem 4. Jahrhundert wäre zu klein gewesen, aber immerhin konnten dort Gottesdienste gefeiert worden. Vor kurzem wurden im See von Iznik die Grundmauen einer gewaltigen Basilika entdeckt, aber die stammt aus späterer Zeit, zum Konzil gab es sie noch nicht.
Die Glaubensüberzeugungen der Teilnehmer des Konzils waren sehr unterschiedlich
Der Einladung des Kaisers waren Bischöfe aus der ganzen Welt gefolgt, jedenfalls soweit sie damals bekannt war. Darunter so illustre Persönlichkeiten wie Nikolaus aus Myra, an den noch immer am Nikolaustag erinnert wird. Auch Gelehrte wie Athanasius der Große waren dabei. Es kamen Bischöfe, Presbyter und Diakone aus Ägypten und dem Balkan, aus Armenien und von der Krim, sogar die Perser und die Goten hatten Gesandte geschickt. Nicht nur die Gewänder der Geistlichen dürften sehr bunt gewesen sein, ebenso ihre Glaubensüberzeugungen. Von einem einheitlichen Christentum war jedenfalls noch nicht die Rede, auch nicht von einer eindeutigen theologischen Haltung. Dazu waren die kulturellen Hintergründe der Ortskirchen zu vielfältig.
Und genau darum ging es auf dieser ersten großen Versammlung. Kaiser Konstantin, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal getauft war, verfolgte politische Interessen. Er wollte Klarheit, damit schwelende Konflikte endlich aufhörten. Und Auseinandersetzungen gab es eine Menge: Einerseits ging es um die Deutung der neutestamentlichen Schriften, andererseits spielte aber auch die typische Auseinandersetzung zwischen den Machtzentren eine Rolle: Wer war bedeutender: die Kirche aus Alexandrien, heute Ägypten, oder die aus Antiochia, heute Türkei. Und Rom und der Rest der Welt wollten auch ein Wort mitsprechen.
Die Konflikte sollten durch einen Kompromiss beendet werden
Vor diesem Hintergrund drängte der Kaiser auf Einigung und wollte unbedingt einen Kompromiss erreichen. Das Ergebnis kam tatsächlich zustande: Es ist die erste Form eines christlichen Bekenntnisses, dem sich zumindest die meisten anschließen konnten. Rückblickend wird es das Nicänische Bekenntnis genannt, nach der Stadt Nicäa. Der etwas kompliziert geschriebene Text wird heute nur noch selten gesprochen, er wurde bei uns im Westen später durch das Apostolische Glaubensbekenntnis ersetzt. Aber für die weltweite Kirche hat das Nicänische Bekenntnis noch immer große Bedeutung. Dort heißt es unter anderem:
Ich glaube an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
den Sohn Gottes,
der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist,
das heißt: aus dem Wesen des Vaters,
Gott aus Gott, Licht aus Licht,
wahrer Gott aus wahrem Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater.
Musik 3: Traditional, Interludium IV, Byzantine Mosaics I (Saint Ephraim Male Choire, Tamas Bubno)
Worum ging es in den Debatten, die damals in Nicäa so erbittert geführt wurden? Welche Punkte waren überhaupt strittig, warum drängte Kaiser Konstantin auf einen Kompromiss? Zunächst wurden ein paar praktische Punkte geklärt, zum Beispiel, wann Ostern gefeiert werden soll. Das war bis zu diesem Konzil ganz und gar nicht klar. Die lokalen Traditionen unterschieden sich: Die einen orientierten sich am Pessachfest, denn Kreuzigung und Auferstehung Jesu fanden im Umfeld dieses jüdischen Festes statt. Andere wollte die christlichen Feiern aus dem jüdischen Kontext lösen. Einige rechneten nach dem Mondkalender, andere mit dem Sonnenkalender. Das alles war unpraktisch. Und mit der gefundenen Einigung, Ostern stets am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond zu feiern, konnte sich die Mehrheit schnell abfinden.
Was war der Inhalt der Gespräche des Konzils in Nicäa?
Etwas verfahrener waren die theologischen Themen. Wenn man ein einheitliches Bekenntnis formulieren wollte, war es unabdingbar, das Wesen Jesu genau zu beschreiben. Die Formulierung als Sohn Gottes bietet Spielraum. War Jesus letztlich mehr Mensch oder mehr Gott? Wenn aber beides, wie sollte dann sein Verhältnis zu Gott, dem Vater beschrieben werden? Es ging also um den Kern der christlichen Botschaft. Am Ende der heftigen Debatten einigte sich die Mehrheit in Nicäa auf eine Formulierung, die drei Punkte hervorhebt:
Ersten: Es ist nur ein einziger Gott!
Zweitens: In Jesus erscheint Gott zwar in menschlicher Gestalt, gehört aber zugleich ganz auf die göttliche Seite!
Drittens: Jesus und Gott Vater sind im Wesen gleich und nicht hierarchisch geordnet! Also: Keiner ist größer als der andere.
Diese Punkte waren wichtig, weil sie einer verbreiteten Meinung entgegentraten. Es gab nämlich eine Fraktion, die Jesus dem Schöpfergott unterordnen wollte. In deren Augen war Jesus eben ein besonderer Mensch, eines der vornehmsten Geschöpfe, aber eben nicht mit dem Schöpfergott wesensgleich. Diese Meinung war damals verbreitet, und auch heute ist sie noch populär. Nicht wenige Christen tun sich schwer mit dieser Auffächerung Gottes in verschiedene Wesenheiten. Sie sehen in Jesus ein menschliches Vorbild, betrachten ihn als prägendes Bild humanistischer Gesinnung. Aber eben nicht als Gott.
Die Gedanken von Nicäa werden auch heute noch weitergedacht
Christoph Markschies ist Professor für Antikes Christentum in Berlin und hat sich ausgiebig mit diesen Fragen befasst. Für ihn liegt gerade in der Frage von Gottheit und Menschheit Jesu der bleibenden Bedeutung von Nizäa:
O-Ton 1: Christoph Markschies
„Das Bekenntnis von Nicäa provoziert dazu, die im Augenblick bei manchen schicke Herabstufung Jesu zu einem menschlichen Weisheitslehrer nicht mitzumachen, das ist so eine Art kleiner Stachel, und daran festzuhalten, dass er ganz auf die Seite Gottes gehört. Ich spreche gerne davon, dass Jesus Christus uns Gott ereignet.“
Author:
Die Formulierung, dass Jesus Christus uns Gott ereignet, ist weitsichtig. Es meint: Erst durch die Gestalt Jesu wird der unfassbare Schöpfergott für uns greifbar. Indem er Mensch wird, bekommt er eine Stimme, wird sichtbar, kann sich den Kranken und Notleidenden zuwenden. Er ereignet sich heißt: er kann in das Geschehen eingreifen. Einerseits wird deutlich, wie beide, Gott Vater und Sohn, im Kern verbunden sind, ja, dass sie wesenseins sind. Andererseits gilt aber auch: Wenn der abstrakte Gedanke an Gott in Jesus zu einem Ereignis wird, dann ist es ein ständig neues Geschehen. Wie Gott in der Welt wirkt, ändert sich und damit auch die Worte, mit denen Christen ihren Glauben beschreiben. Deshalb sind die Gedanken von Nicäa sind niemals zu Ende gedacht.
Musik 4: Claude Debussy, La Cathédrale engloutie, Debussy et le jazz (Quatuor Debussy)
Welchen Sinn macht es, nach 1700 Jahren wieder an dieses erste Konzil der Christen zu erinnern? Während ich durch die geschichtsträchtigen Gassen von Iznik schlendre, rufe ich die alten Diskussionen in Erinnerung. Damals war es der Streitpunkt, ob Gott Vater und Jesus Christus nun wesensgleich, wesensähnlich oder wesenseins sind. Diese Diskussion erscheint den meisten Menschen eher abwegig. Dogmatische Aussagen genießen sowieso keine hohe Beliebtheit. Kritisiert wird überdies die Strenge, mit der Glaubensaussagen damals durchgedrückt wurden.
Ist Gott Vater und Jesus Christus wesensgleich, wesensähnlich oder wesenseins?
Ob der Glaube sich überhaupt noch in Formeln pressen lässt? Da ist Skepsis verbreitet. Inzwischen ist in Glaubensfragen mehr Liberalität gefragt. Gerade in der evangelischen Kirche will sich niemand bevormunden lassen. Und doch sieht Christoph Markschies mit großem Respekt auf die Bemühungen um einen Kompromiss, der damals zur Einheit der Kirche führte. Und dieser Respekt nährt sich nicht nur aus historischer Sicht, sondern kommt für ihn auch aus der persönlichen Erfahrung, dass das Gerüst einer Formel für den Glauben wichtig sein kann:
O-Ton Christoph Markies:
Ja, man muss Glauben in Formeln bringen, weil man sonst die Wunder dessen, was Gott an uns tut, aus eigener Kraft nicht formulieren kann. Der Satz „Er ist wahrhaftig auferstanden“ aus meinem Mund ist irgendwie größenwahnsinnig, den bringe ich gar nicht über die Lippen. Aber den Satz „Er ist wahrhaftig auferstanden“ als ein Zeugnis, das mir jemand weitergibt, und das ich als Teil einer Gemeinschaft aufnehme und fröhlich weitersage, ist, mal sehr pointiert formuliert, lebensrettend.“
Einheitliche Formulierungen können manchmal hilfreich sein
Author:
Formeln können helfen! Dann nämlich, wenn ich nicht selbst um Formulierungen ringen muss, stattdessen auf das rückgreifen darf, was über Generationen weitergegeben wurde. Die Osterbotschaft von der Auferstehung ist so eine Formel; oder die Segensworte, die schon von den Priestern im Alten Testament benutzt wurden und noch heute am Ende jedes Gottesdienstes stehen. Worte und Formeln, die authentisch und würdig wirken, und doch immer wieder aktuell erscheinen, ja mich persönlich treffen können. So gesehen ist das Bekenntnis kein Korsett, in das ich eingezwängt werde. Vielmehr entlastet es von zu hohen Ansprüchen und kann mich wohltuend in eine Gemeinschaft einbinden.
Die größte Errungenschaft von Nizäa liegt für mich im Willen zum Kompromiss. Erst dadurch entsteht Gemeinschaft im Glauben, das, was die Kirche im Innersten zusammenhält. Der Kern ist die Gewissheit, dass in Christus Gott selbst Mensch geworden ist. Sein Wesen erschöpft sich nicht darin, ein vorbildlicher Mensch zu sein, kein Weisheitslehrer und auch nicht bloß Prophet.
Das alles geht mit durch den Kopf, während ich die antike Stätte in Iznik umrunde. Eine christliche Gemeinde gibt es hier nicht mehr, aber den Geist von Nicäa spüre ich noch immer: Im Bekenntnis, dass von Christus Versöhnung ausgehen kann, eben weil er kein Geschöpf, sondern ganz Gott ist. Das war das Ergebnis dieses ersten christlichen Konzils.
Musik 5: Claude Debussy, La Cathédrale engloutie, Debussy et le jazz (Quatuor Debussy)
[i] Gürhan Akdoğan: „Ayasofya'nın camiye çevrilmesi İznik'in turizmine vurulmuş en büyük bir darbedir“, [https://iznikdefteri.com/gurhan-akdoganvatandas-olarak-endiseliyiz/]