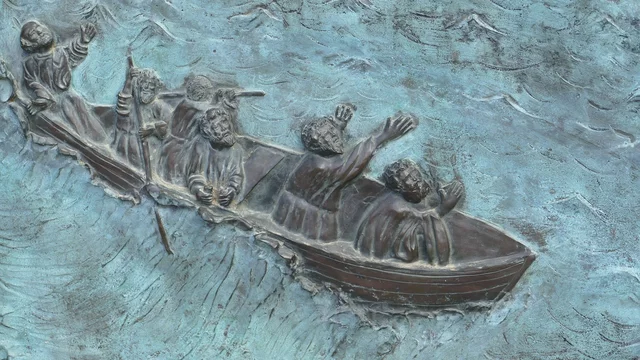Glaube und Geld – unvereinbar?
Jesus legt seinen Zuhörern einmal einen problematischen Fall dar. Es geht um einen Verwalter. Der wird beschuldigt, das Vermögen seines Dienstgebers zu veruntreuen. Er wird zur Rechenschaft gerufen. In dieser Situation vergewissert er sich rasch des Wohlwollens etlicher seiner Klienten. Das macht er mit enormer krimineller Energie: Er fordert sie auf, ihrerseits vereinbarte Zinszahlungen zu unterschlagen. Er sichert ihnen dabei Deckung zu und zeichnet ihre Belege gegen. Er ist überzeugt: Das wird ihm, wenn ihm sein Job nun entzogen wird, Sicherheit und Unterkommen garantieren.
Ohne weiter auf die Unterschlagungen einzugehen, beurteilt Jesus das Verhalten des Verwalters überraschend als klug. Er sei klug, weil er sich mit dem – O-Ton Jesus – „ungerechten Mammon“ Freunde gemacht habe. „Mammon“ ist ein Wort aus dem Aramäischen, der Sprache Jesu. Es bezeichnet Besitz und Vermögen. Jesus verwendet es meist in negativem Sinn.
Das abschließende Fazit Jesu lässt keinen Spielraum: „Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen, und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den großen.“ Jesus fährt fort: „Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das Eure geben?“
Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon
Es folgt ein Lehrsatz: „Kein Sklave kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen und den andern lieben oder er wird zu dem einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon."
„Das wahre Gut“: Es besteht für Jesus nicht in Vermögen, Geld, Besitz oder Macht. Was wirklich zählt im Leben, da werden die meisten seiner Zuhörer damals wie heute zustimmen, ist etwas ganz anderes. Viele werden an Zuwendung, Geborgenheit, sicher auch Gesundheit, Zufriedenheit denken. Insofern ist die „Klugheit“, die Jesus dem Verwalter zuspricht, nur eine eher oberflächliche „Schläue“. Im Blick auf das, was wirklich gilt, hat sie keinen Bestand und keinen Wert.
Wie aber ist es mit Geld und Besitz? Gott und Mammon – sind das zwei Gegenentwürfe? Ist Besitz, ist Geld an sich schlecht? Die jüdische Bibel kennt und formuliert an etlichen Stellen das Verbot, Geld gegen Zinsen auszuleihen: „Wenn dein Bruder verarmt ..., sollst du ihn, auch einen Fremden ..., unterstützen, damit er neben dir leben kann. … Du sollst ihm weder dein Geld noch deine Nahrung gegen Zins und Wucher geben.“
Zinsverbote kennen in ganz ähnlicher Weise das frühe Christentum und der Islam. Karl der Große macht aus der internen christlichen Regel im 8. Jahrhundert schließlich sogar ein weltliches Verbot, ein Gesetz. Über Jahrhunderte hat diese Vorstellung nachgewirkt. Mammon, Geld und Religion – ein unversöhnlicher Widerstreit. Und heute?
Musik: Johann Sebastian Bach - Kantate 45 „Es ist dir gesagt, was gut ist“ - Netherlands Bach Society unter Hans-Christoph Rademann
Kirche und Geld – passt das zusammen
„Es war eine schöne Taufe“, sagt der Großvater beim Mittagessen ganz zufrieden. Am Vormittag hatte ich die Zeremonie in einem malerischen Dorfkirchlein geleitet. Eine Menge Verwandter war dabei gewesen. Der Großvater ist ein pensionierter Kollege aus meiner Schule. „Du musst da eine Charme-Offensive starten, weißt du“, hatte er einige Wochen zuvor gesagt. Da hatte er mich gebeten, seinen Enkel zu taufen. Sein Sohn sei nämlich Banker. Und wenn der aus der Kirche austrete, da ginge ihr eine Menge Geld flöten. Der Steuerberater fordere den Sohn regelmäßig dazu auf, ergänzte er. Ob der Papa des kleinen Valentins wegen der schönen Taufe nun weiter Kirchensteuer zahlen wird? Oder ob er es tun wird, damit seine Kinder einmal eine kirchliche Schule besuchen können? Ich weiß es nicht.
Kirche und Geld – ein leidiges Thema. Natürlich ist Geld hilfreich; natürlich ermöglicht das System der Kirchensteuer in unserem Land eine Menge Aktivitäten in Caritas und Diakonie, in Bildung und Schule, in der Pastoral. Trotzdem bleibt bei mir oft ein fahler Beigeschmack, wenn ich mit dem Thema konfrontiert werde. „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ Das Wort Jesu hallt nach. Ist Geld so schlimm?
Geld, Besitz und die Kirche – eine schwierige Verbindung
Yuval Noah Harari ist ein renommierter Historiker aus Israel und Verfasser internationaler Bestseller. In seinem Buch „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ widmet er sich auch der Erfindung des Geldes und seiner Funktion. Er bewertet es positiv: Geld habe grundlegend mit Vertrauen zu tun, erklärt Harari. Geld existiere eigentlich gar nicht wirklich, sondern nur in der kollektiven Vorstellung von Menschen. Erst Geld mache möglich, dass Menschen global zusammenleben. Denn Menschen vertrauen Münzen, ganz egal aus welchem Land, von Menschen welcher Weltanschauung auch immer sie stammen.
In manchen Orten meiner Umgebung stehen heute noch beeindruckende Gebäude: Sie haben über Jahrhunderte als Zehntscheunen gedient. Hier wurden Steuern in Form von Naturalien aus allen Höfen des Dorfes gesammelt. Was ein Aufwand an Immobilien, an Transport und Verwaltung. Wie ungleich effizient gestaltet sich im Vergleich damit Geldwirtschaft. Ein Loblied auf den Kapitalismus?!
Papst Franziskus hörte sich da ganz anders an. „Nein zu einer … Vergötterung des Geldes … Nein zu einem Geld, das regiert statt zu dienen!“ In seiner Enzyklika Evangelii Gaudium haben solche Sätze 2013 und danach immer wieder für Aufhorchen und auch Aufregung gesorgt. „Die Kultur des Wohlstands betäubt uns“, urteilte der Argentinier auf dem Thron Petri. Er beklagte die „Beziehung, die wir zum Geld hergestellt haben“. Er begründete: „Friedlich akzeptieren wir seine Vorherrschaft über uns und über unsere Gesellschaften. Die Finanzkrise … lässt uns vergessen, dass an ihrem Ursprung … steht: die Leugnung des Vorrangs des Menschen! Wir haben neue Götzen geschaffen.“ Vom „Fetischismus des Geldes“ spracht er, und er forderte, dass wir uns davon befreien.
Musik: Johann Sebastian Bach - Kantate 45 „Es ist dir gesagt, was gut ist“ - Netherlands Bach Society unter Hans-Christoph Rademann
Berufung des Matthäus Caravaggio
Im Umgang mit Geld ist Jesus zweifellos Realist. Die Evangelien überliefern Worte, in denen er vom Geld verleihen spricht und davon, dass man damit Zinsen erwirtschaften kann. Er kennt und verwendet offenbar auch römische Münzen. Sein Umgang mit den sogenannten Zöllnern, den Steuerpächtern und Steuerbeamten seiner Zeit und Umwelt, ist aufgeschlossen und zugewandt. So sehr, dass ihm seine Gegner das häufig zum Vorwurf machen. Ein Zöllner ist für Jesu Landsleute eine ungeliebte Erscheinung; Kollaborateur der römischen Besatzungsmacht. Fragwürdig und anstößig ist seine Tätigkeit. Er kann seinen eigenen Gewinn mehr oder weniger nach Gutdünken gestalten. So sieht es das antike römische Steuersystem vor.
Einer der Apostel hat, folgt man der Tradition, eine Vorgeschichte als Zöllner: Es ist Matthäus. Heute ist im kirchlichen Kalender sein Festtag. Sein Weg mit Jesus beginnt, so berichten die Evangelien von Markus, Lukas und Matthäus übereinstimmend, spektakulär: nämlich gleichsam im Vorübergehen. Im Vorbeigehen berichten die Evangelisten, sieht Jesus ihn an seiner Zollstelle sitzen. Er fordert ihn auf, mit ihm zu gehen. Und Levi alias Matthäus steht auf und macht das – ohne lange Umschweife. Matthäus folgt Jesus.
Ein altes Bild und seine aktuelle Aussagekraft
Der italienische Maler Caravaggio hat diese Begegnung im 17. Jahrhundert virtuos in Szene gesetzt: Jesus betritt, begleitet von Petrus, einen halbdunklen Raum. Fünf Männer sitzen um einen Tisch mit Geldmünzen. Jesu Blick und seine rechte Hand richten sich auf die Gruppe. Einer der Männer, der in der Mitte, schaut Jesus erstaunt an und deutet mit seinem Zeigefinger auf…, da wird es schwierig… Die meisten Interpreten sind sicher: auf sich selbst. Er ist Matthäus, sind sie überzeugt. Bart und Frisur des reifen Mannes passen zu anderen Matthäus-Bildern des Malers. Seine rechte Hand ruht noch auf dem Geld auf der Tischplatte. Die anderen vier Männer am Tisch: Zwei, noch fast jungenhaft, schauen verblüfft in Jesu Richtung. Ein vierter Mann, ein älterer mit Brille, beugt sich unbeeindruckt von hinten über Tisch und Münzen. Die wiederum zählt gerade der fünfte im Bunde: Seine rechte Hand zumindest ist mit den Münzen beschäftigt. Er sitzt am Kopfende des Tisches, Jesus gegenüber. Ein junger Erwachsener.
Er ist dicht an den Tisch herangerückt, seinen Kopf neigt er vornüber, ganz den Münzen zugewandt, völlig auf sein Zählen konzentriert. Sein Blick und seine Stirnpartie sind wegen seines dunklen, dichten Haars kaum zu erkennen. Ist nicht vielleicht er der Zöllner? Richtet der Zeigefinger sich auf ihn? Diese Deutung gibt das Bild, meinen manche, durchaus ebenfalls her. Diese Deutung gefällt mir.
Da ist einer, der so sehr dem Mammon, dem Geld zugewandt ist, dass er das Eintreten Jesu gar nicht zu bemerken scheint; jedenfalls lässt er das nicht erkennen. „Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon.“ Der, den Jesus anspricht, der muss sich entscheiden. Für diesen jungen Mann ist das eine wirkliche Aufgabe. Noch ist er ganz beim Mammon.
An der Vorderseite des Tisches in der Zollstube, die der Maler Caravaggio in seinem Bild geschaffen hat, ist freier Raum: Da ist ein ganzer Platz leer. Der Betrachter des Bildes steht heute nicht anders als im 17. Jahrhundert, wenn er die Kirche San Luigi dei Francesi bei der Piazza Navona in Rom betritt, an dieser Stelle. Zeit und Raum verschwimmen hier: Jesus und Petrus sind in Kleider aus biblischer Zeit gehüllt. Die Gewänder des Matthäus stammen aus der Ära Caravaggios. Die ausgestreckte Hand Jesu ähnelt der Hand des Schöpfers in der Sixtinischen Kapelle. Michelangelo hat sie 100 Jahre zuvor gemalt. Kein Zufall. Die Aufforderung, das Münzenzählen zurückzulassen, richtet sich an ausnahmslos alle – egal wann, egal wo.
Musik: Felix Mendelssohn-Bartholdy - „Grave“ aus der Sonata in c-moll Nr. 2, op. 65 - Bernhard Schneider an der Klais-Orgel von St. Aegidien
Besitzen als wenn man nicht besitzen würde
„Sei kein Pfennigfuchser“, rügt mich ein Freund vor einiger Zeit. Mein Rennrad ist in die Jahre gekommen. Da sind ein paar Reparaturen nötig; es sind nicht mehr alle Ersatzteile zu haben. Dieses Rad ist mein treuer Begleiter seit langem. Nein, es hat keine elektronische Gangschaltung und – nein, Scheibenbremsen hat es auch noch nicht. Das ist längst Standard, ich weiß. So ein Sportgerät kostet neu allerdings auch eine Menge Geld.
Die Rüge macht mich nachdenklich: Hänge ich zu sehr am Geld, um ein neues Rad zu kaufen? Ein seltsamer Widerstreit ist das: großzügig mit dem eigenen Vermögen sein, nicht geizig. Das finde ich richtig. Gleichzeitig aber auch nicht prassen, im Überfluss schwelgen. Warum soll ich etwas kaufen, wenn es nicht nötig ist? Oder rede ich mir das ein?
Vor ein paar Jahren war ein befreundeter Mönch bei mir zu Gast. Als ich ihn am Ende der Woche zurück zum Bahnhof bringe, sprudelt es aus ihm heraus: „Und ich dachte, du hättest ein tolles Leben! Was du alles bedenken und organisieren musst: einkaufen und planen, wirtschaften und finanzieren. Bin ich froh, dass das für unser Kloster ein oder zwei Profis machen. Das schafft mir eine Menge Freiraum. Danke für die Erfahrung. Das hatte ich wohl vergessen.“
Großzügig, nicht geizig, besitzen aber nicht verprassen - eine schwierige Balance
Viele Ordensleute folgen den sogenannten „Evangelischen Räten“. Die Tradition zählt dazu auch die Armut, den Verzicht zumindest auf größeren persönlichen Besitz. Zeitweise entstand dadurch der Eindruck, dass es so etwas wie ein Zwei-Klassen-Christentum gibt: auf der einen Seite die, die dem Evangelium strikt und konsequent folgen, und daneben die, die eine „Light-Version“ umsetzen.
Der Theologe Paul Zulehner hat vor etlichen Jahren diese Deutung korrigiert: Der Verzicht auf Eigentum zielt, schreibt Zulehner, auf eine Ursehnsucht von uns Menschen, den Besitz. Das ist die Sehnsucht nach Heimat. Diese Sehnsucht ist im letzten aber, wie alle Ursehnsüchte, maßlos und unerfüllbar. Niemand kann so viel besitzen, dass er nicht noch mehr, noch etwas anderes haben will. Niemand besitzt für immer; Menschsein bedeutet immer auch vergänglich, vorübergehend sein.
Zulehner ist überzeugt, dass eine Sehnsucht wie die nach Besitz kultiviert, gepflegt werden kann und muss. Dann kann sie in einen gelingenden Lebensentwurf eingebunden werden. Er ermuntert dazu, Besitz dankbar anzunehmen, ihn auch zu genießen. Entscheidend ist dabei das Bewusstsein, dass unsere eigentliche Sicherheit, unsere wirkliche Heimat nicht Geld und Besitz sind. Wenn wir uns stattdessen in Gott verorten, dann hilft uns das, in liebendem Füreinander mit Besitz umzugehen.
Gott und der Mammon. Sind beide also doch vereinbar? Jesu Wort ist eindeutig: Dem Mammon nicht dienen. „Sich vom Besitz nicht besitzen lassen.“ Zulehner formuliert: „So besitzen, als besäße ich nicht.“ Was paradox klingt, ist für Christen seit 2.000 Jahren eine bleibende und vor allem nicht unmögliche Herausforderung und Aufgabe. Und nicht nur für Christen. Das ist der Ruf an Matthäus, an jede und jeden von uns. Diesem Ruf zu folgen macht uns neu - und befreit uns aus dem dunklen Raum und dem Tisch mit den Münzen und lässt uns hinaustreten ins Licht.
Musik: Dan Schutte - „Here I am Lord“ - Choir of Hexham Abbey, Leitung: Michael Haynes, Bernhard Schneider an der Klais-Orgel von St. Aegidien
Musikauswahl: Schul – und Kirchenmusiker Dr. Paul Lang, Amöneburg