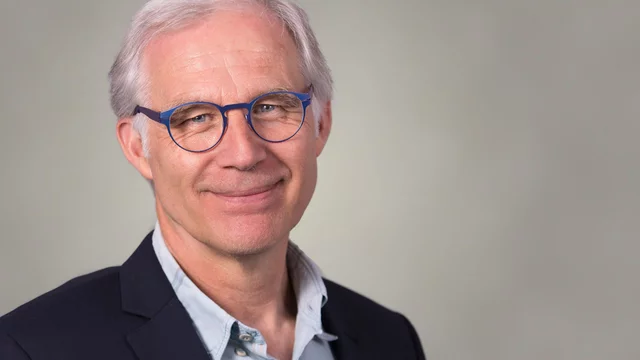Betreten auf eigene Gefahr – vom Umgang mit dem Risiko
Als Kind bin ich mit anderen Kindern zusammen gerne durch einen nahen Wald gestreunt. Einmal stießen wir im Unterholz auf einen unterirdischen Eingang. Eine Stahltür davor. Die war verrostet, aber nicht verschlossen. Mit vereinten Kräften konnten wir sie ein Stück öffnen und hineinschlupfen. Das Dunkel dahinter wirkte bedrohlich.
Abenteuer erleben und lernen auf sich aufzupassen
Wir wussten: Hier betreten wir Abenteuerland und wir müssen uns vor Gefahren hüten. Wir müssen selbst auf uns aufpassen. Nach wenigen Metern war es so dunkel, dass wir nichts mehr sehen konnten. Es knirschte unter unseren Schuhen. Achtung: Da lagen offenbar Glasscherben. Wir gingen zurück und kamen einen Tag später mit Taschenlampen zurück. Nun sahen wir die Glasscherben und sahen uns vor ihnen vor. Wir entdeckten alte Dosen und Zeitschriften und inspizierten sie vorsichtig. Weitere Türen führten zu weiteren Räumen. Ein altes Bunkergelände, wie ich heute weiß. Für uns war es damals ein aufregendes Abenteuer. Wir lernten darin, auf uns aufzupassen.
Junge Menschen brauchen Risiko-Kompetenz
Ich bin bis heute froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Kinder späterer Jahrgänge konnten das nicht mehr. Der Bunker wurde zugeschüttet. Diese und andere Gefahrenquellen wurden in den vergangenen Jahrzehnten nahezu überall eliminiert. Seen eingezäunt, Baden verboten und vieles mehr. Das Leben vieler Kinder ist damit zweifellos ein bisschen sicherer geworden. Aber wer alle Risiken verbannen will, stößt auf ein neues Risiko: Das Risiko einer unvollkommenen Persönlichkeitsentwicklung. Mir scheint: Um erwachsen zu werden, brauchen Menschen auch das Erlebnis, Gefahren gemeistert zu haben. Sie brauchen Risiko-Kompetenz. Der Unternehmer und Glücksforscher Florian Langenscheidt spannt den Bogen noch weiter und sagt: „Glück ist eine Überwindungsprämie dafür, dass man sich etwas getraut hat und trotz Risiko durchgezogen hat.“ 1
Wer nicht, wagt, der nicht gewinnt?
In Wirtschaftskreisen gilt das sogar als Grundsatz: Kein Gewinn ohne Risiko. Zunächst muss man sich was trauen, investieren. Erst später erfährt man, ob sich der Einsatz gelohnt hat. Ein Vers aus biblischer Zeit warnt dagegen: „Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um.“ (Jesus-Sirach 3,26)
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker
Das wird in unserer Gesellschaft weithin beachtet. Dem Staat obliegt die Fürsorge für die Bürgerinnen und Bürger. Und er setzt viel daran, Risiken zu eliminieren. Wer könnte etwas dagegen haben? Wohl niemand. Aber so einfach ist das nicht. Das hat auch die Corona-Pandemie gelehrt. Maßnahmen, die die Gesundheit schützen, haben soziale Nebenwirkungen. Wenn Läden und Gaststätten geschlossen werden, verlieren die Beschäftigen ihre Existenz und ihre Kunden ein Stück Lebensqualität. Es ist wie bei den Medikamenten: Sie helfen, sie heilen. Aber: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin. Rund um das Risiko gibt es also einiges zu ergründen. Das will ich tun, indem ich Antworten auf fünf Fragen finde.
Musik: Michail I. Glinka, Kamarinskaya (Janis Medins, Klavier; Detroit Symphony Orchestra unter Neeme Järvi)
Die Rolle des Risikos im Leben
Als erstes frage ich nach der Rolle des Risikos im einzelnen Leben. Dazu hat jede und jeder ein ganz eigenes Verhältnis. Es hat mit Alter, Geschlecht und Persönlichkeit zu tun. Junge Menschen sind risikobereiter. Das könnte einen verwundern, haben sie doch noch mehr Leben zu verlieren als die Alten. Aber die Alten wissen das, was ihnen noch bleibt, besser zu schätzen und zu schützen. Dahinter stecken natürlich auch die Hormone. Risikobereitschaft hängt mit Testosteron zusammen. Davon haben junge Männer am meisten, deshalb sind sie auch am risikofreudigsten.
Gefahren bewußt in Kauf nehmen, um andere zu schützen
Manche nehmen Risiken bewusst in Kauf – für eine gute Sache. Dazu zählen Feuerwehrleute und Seenotretter. Auch Soldatinnen und Soldaten, derzeit insbesondere in der Ukraine, und Probanden bei Medizin-Tests. Sie riskieren ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben, um andere zu schützen. Dafür gebührt ihnen Dank und Hochachtung.
Der Kick für risikofreudige Adrenalinjunkies
Andere nehmen Risiken nicht nur in Kauf, sondern suchen sogar ganz bewusst danach. Sie sagen: Niemals fühlen wir uns so intensiv lebendig wie im Moment höchster Lebensgefahr. Etwa bei Extremsportarten wie Wingsuit-Springen. Dabei stürzen sich Menschen mit Fluganzügen Steilhänge hinunter und gleiten in hohem Tempo an Bergen entlang und durch enge Felsenspalten hindurch. Andere fahren mit Skiern oder Fahrrädern in hohem Tempo steile Berge hinab, links und rechts scharfe Felsen, die sie töten können, wenn sie stürzen. So extrem sind nur wenige. Viele spielen mit dem Risiko auf niedrigerem Niveau, indem sie Drachen fliegen, Skifahren oder Motorrad oder anderes. Risiken mache das Leben interessant. Umgekehrt: Ein immer und überall sicheres Leben ist auch ein langweiliges Leben.
Viele möchten die Faszination des Risikos zwar erleben, aber ohne es wirklich eingehen zu müssen. Das ist möglich, indem man anderen dabei zuschaut, wie sie Gefahren bestehen. Etwa in Filmen. Im Internet sind ungezählte Filme über Extremsportler zu finden. Beim Schauen stockt einem der Atem. Nicht wenige enden mit dem Hinweis, wann die Person dabei zu Tode gekommen ist.
Musik: Kurt Atterberg, Drammatico (SWR Radio-Sinfonieorchester Stuttgart unter Ari Rasilainen)
Macht es beim Risiko einen Unterschied, ob jemand an Gott glaubt?
Manchmal sieht man, dass Extremsportler sich bekreuzigen, kurz bevor sie halsbrecherisch den Berg hinunterfahren oder fliegen. Sie machen sich dabei bewusst, dass sie an ihre Grenzen gehen – und vielleicht auch darüber hinaus. Dafür bitten sie um Gottes Beistand. Andere erleben diesen Moment nicht als Begegnung mit Gott, sondern als Ganz-und-Gar-Erfahrung ihrer selbst, indem sie ihr Leben allein ihrem eigenen Können anvertrauen. Dem will ich in meiner zweiten Frage noch etwas nachgehen: Macht es beim Risiko einen Unterschied, ob jemand an Gott glaubt? Das Wort Risiko findet man in der Bibel nicht. Auch nicht im evangelischen Gesangbuch. Wohl aber den Begriff der Gefahr. Und die gilt in den Texten als unvermeidlich. Gefahren gehören zum Leben, wie die Hoffnung, dass Gott gegen Gefahren schützt und in Gefahren beisteht. Dieses Gottvertrauen drücken viele Liedverse aus wie zum Beispiel dieser:
Gott, ich danke dir von Herzen,
dass Du mich in dieser Nacht
vor Gefahr, Angst, Not und Schmerzen
hast behütet und bewacht,
dass des bösen Feindes List
mein nicht mächtig worden ist.
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 445, 2)
Glaube ohne Garantie
Ein Aufatmen am Morgen: Nacht gut überstanden. Mit Gottes Hilfe. Das klingt einfach. Einfacher als es ist. Denn der Glaube ist ja keine Versicherung, gibt keine Garantie. Er ist eine Hoffnung, ein Zutrauen in Gott. Der Glaube mag helfen, gelassener auf die Risiken des Lebens zu schauen. Aber der Glaube bringt auch ein eigenes Risiko mit sich: Niemand weiß im Vorhinein, was Gott tut, zulässt, bewirkt. Man gibt sich in Gottes Hand und hat damit nur eine Gewissheit: Ich habe eine Heimat bei Gott, die kann mir niemand nehmen, auch wenn das Leben vergeht.
Was bewirkt Glaube in mir?
Kommen die, die an Gott und seine Schutzengel glauben, besser mit den Risiken zurecht? Sind sie gar risikofreudiger? Oder versuchen sie eher Risiken zu vermeiden? Schließlich sehen sie ihr Leben als Gabe Gottes und wollen es entsprechend gut behüten. Beides kann stimmen. Und meines Erachtens kann man das nicht gegeneinander aufwiegen. Der christliche Glaube gibt hier keine Normen vor, keine richtigen und keine falschen Wege. Man muss in sich hineinhören, was der Glaube in einem bewirkt und wie sich das auf das eigene Risikoverhalten auswirkt.
Musik: Kurt Atterberg, Symphony No. 2 F-Dur (Frankfurt Radio Symphony Orchester unter Ari Rasilainen)
Gesellschaftliche Regeln und Vorschriften machen die Alltagswelt immer sicherer
Mit meiner dritten Frage schaue ich mich in der Gesellschaft um: Wie Risiko-mündig ist sie, wie mündig sind wir?
Die Gesellschaft in Deutschland heute versucht, Risiken zu minimieren. Das muss sie auch, denn dem Staat kommt eine Fürsorgeplicht für seine Bürgerinnen und Bürger zu. Deshalb gibt es immer mehr Regeln, um Risiken vermeiden. Nur drei Beispiele, die für Tausende stehen: Höhe und Länge der Treppenstufen sind vorgeschrieben, damit dort möglichst niemand stolpert. Tempolimits gelten auf fast allen Straßen, damit dort niemand zu Schaden kommt. Höchstwerte bei der Luftverschmutzung sollen sicherstellen, dass sich niemand vergiftet.
Zig-Tausende Sicherheitsvorschriften machen die Alltagswelt sicher und – weil jährlich neue hinzukommen – auch immer sicherer. Auf den Spielplätzen ist es ziemlich langweilig geworden, finde ich. Denn alle Spielgeräte, die irgendwie besonders Spaß gemacht haben, wurden abmontiert, weil sie mit einem Risiko verbunden waren.
Im Privatbereich: Helikoptereltern und Versicherungen für alles
Im Familienkreis setzt sich das fort. Berühmt und vieldiskutiert sind die sogenannten Helikopter-Eltern, die unablässig um ihre Kinder kreisen, sie überallhin fahren und begleiten, damit ihnen ja nichts zustößt. Eltern statt Schutzengel, Überbehütung statt Risiko. Wo Risiken bleiben, springen Versicherungen ein. Das berühmte Rundum-Sorglos-Paket, mit dem man sich gegen fast alle Risiken absichern kann. Das ist alles verständlich und schützt Menschen.
Eine Rundum-Fürsorge kann den Blick auf’s Leben verfälschen
Doch diese Rundum-Fürsorge kann auch eine bestimmte Mentalität hervorbringen. Viele Menschen sehen bei sich kaum noch Verantwortung für sich selbst. Und haben nicht mehr im Blick, dass es kein Leben ohne ein gewisses Risiko gibt. Wenn etwas Schlimmes passiert, lautet ihre erste Frage nicht: Wie kann ich damit fertig werden? Sondern: Wen kann ich dafür verantwortlich machen? Wer bezahlt mir den Schaden? Vielen fehlt es an Risiko-Mündigkeit, so formuliert es der Risikoforscher Ortwin Renn 2.
Risiko-Müdigkeit - Gefahr für die Zukunft
Diese Risiko-Müdigkeit wird für die Zukunft aber immer gefährlicher, denn die Menschheit steht vor großen Risiken. Das renommierte SIPRI-Friedensforschungsinstitut in Stockholm sieht sogar ein ganzes Risiko-Zeitalter 3 aufziehen, weil sich viele ungelöste Fragen miteinander verzahnen und komplizierte Konflikte schüren: Umweltfragen, Mangel an Ressourcen wie Wasser und Energie, geopolitische Konfliktherde, Fluchtbewegungen – zusammen ergeben sie riskante Mehrfachkonflikte. Zu lösen sind sie nur mit einem gemeinsamen und klugen Risiko-Management. Ohnehin lassen sich nicht alle Risiken vermeiden.
Musik: Igor Stravinsky, Rondo (English Chamber Orchestra unter Sir Collin Davis)
Eine fürsorgliche Gesellschaft muss Kompromisse eingehen
Meine vierte Frage lautet: Wie komme ich mit den Risiken zurecht, die ich nicht vermeiden kann?
Die fürsorgliche Gesellschaft bemüht sich zwar redlich, Risiken auszuschließen, aber am Ende muss sie doch Kompromisse eingehen. Etwa beim Autoverkehr. Strenge Verkehrsregeln verringern die Zahl der Verkehrsopfer. Wollte man aber die Zahl der Opfer auf null bringen, dürften alle auf den Straßen nur noch Schritttempo fahren. Die Folgen wären so gravierend, dass alle stillschweigend das Risiko von Unfällen und Opfern akzeptieren.
Ein Restrisiko bleibt immer
Auch an vielen anderen Stellen wird abgewogen: Welche Risiken nehmen wir in Kauf? Dafür hat sich ein prägnantes Wort eingebürgert. Es lautet: Restrisiko. Der Begriff entstand in der Debatte um die Atomkraft. Zu Beginn behaupteten die Befürworter felsenfest, Atomkraftwerke seien absolut sicher. Dann kamen die ersten Störungen und ernsthaften Unfälle. Die Befürworter mussten zugeben, dass diese Technologie doch nicht absolut sicher ist. Sie prägten den Begriff vom Restrisiko. Das ist ehrlicher und ermöglicht eine Debatte, ob die Mehrheit der Gesellschaft dieses Risiko eingehen will. Ich jedenfalls bin an dieser Stelle froh, wenn alle Risiken so gründlich wie irgend möglich ausgeschaltet werden. Hier hat Sicherheit höchste Priorität, weil die Folgen eines Unfalls schrecklich sind und das womöglich für Jahrhunderte oder gar Jahrtausende. Doch es gibt andere Fragen und Lebenslagen, da will ich das Restrisiko annehmen. Der Schriftsteller Erich Kästner beschreibt es so: "Wirds besser? Wirds schlimmer?; Fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich! Leben ist immer lebensgefährlich." 4
Niemand hat sein Leben absolut im Griff
So vorsichtig man auch ist, es bleibt eine Sicherheitslücke. Niemand hat sein Leben absolut im Griff. Menschen sind immer Bedrohte und Angewiesene. Deshalb werden gläubige Menschen auch immer darauf hoffen, dass Gott ihr Leben beschützt. Wie es ein Psalm beschreibt:
Mein Leben ist immer in Gefahr,
aber dein Gesetz vergesse ich nicht.
Du bist mein Schutz und mein Schild,
ich hoffe auf dein Wort. (Psalm 119, 109 und 114)
Musik: Nico Muhli, A Hudson Circle (Lavinia Meijer, Harfe)
„Betreten auf eigene Gefahr“
Meine letzte Frage führt zu mir zurück: Wie stehe ich eigentlich selbst zum Risiko? Mein persönliches Motto zum Thema Risiko steht auf den Schildern mit den Worten: „Betreten auf eigene Gefahr.“ Dann weiß ich: Hier darf ich etwas. Hier wird mir etwas zugetraut. Hier besteht ein Risiko, das ich auf mich nehmen oder eben gehen muss. Wenn jemand sagt „auf eigenes Risiko“ klingt das fast immer wie ein warnender Zeigefinger und meint: Finger weg. Ich begreife es aber meist als Einladung zum Selberdenken.
Die Verantwortung für mein Handeln übernehmen
Damit kein Missverständnis aufkommt: Ich bin kein Wingsuit-Flieger oder ähnliches. Ich spiele nicht mit meinem Leben, um mir einen Hormon-Kick zu geben. Und ich habe auch für manche Widrigkeiten eine Versicherung abgeschlossen. Aber ich möchte nicht auf alles verzichten, was ein Risiko birgt. Auf eigene Gefahr - das bedeutet für mich auch: Wenn etwas passiert, dann schaue ich nicht zuallererst und in jedem Fall, wer mir jetzt den Schaden ersetzt oder wer schuld ist. Denn es ist klar: Oft bin ich selbst verantwortlich und habe die Folgen zu tragen. Wenn ich das nicht kann oder will, dann fange ich damit gar nicht erst an.
Glaube kann risiko-fähiger machen
Diese Haltung ergibt sich für mich auch aus meinem Glauben: Ich nehme mich als verantwortungsfähigen Menschen ernst und zugleich lebe ich im Vertrauen auf Gott. Denn ich stelle mir vor, dass Gott mich und alle anderen Menschen so gemeint hat: als einen, der gerne lebt und auch gerne etwas ausprobiert. Der das Leben liebt und sich darum sorgt. Der Verantwortung übernimmt, für das, was er tut oder nicht tut. Der sich in Gottes Schöpfung verantwortungsvoll zu schaffen macht. Wozu sonst sollte all die Freiheit dienen, die Gott den Menschen eröffnet hat?
Glauben zu können an einen Gott, der mich sieht und mit mir etwas vorhat, das minimiert nicht das Risiko eines Schadens. Aber es gibt mir das Vertrauen, dass mein Leben in einem größeren Horizont steht. Das macht mich gelassener, nicht risikofreudiger, aber vielleicht ein wenig risiko-fähiger.
Musik: Kurt Atterberg, Sinfonie Nr.4, 3. Satz Scherzo (Frankfurt Radio Symphony Orchester unter Ari Rasilainen)
1 Offenbach Post, 16.1.2023, Seite 7
2 Ortwin Renn, Das Risikoparadox – Warum wir uns vor dem Falschen fürchten, Fischer, 2014
3 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Environment of Peace: Security in a New Era of Risk, zitiert nach Offenbach Post, 24.05.2022
4 beruhmte-zitate.de/zitate/670489-erich-kastner-wirds-besser-wirds-schlimmer-fragt-man-alljah/